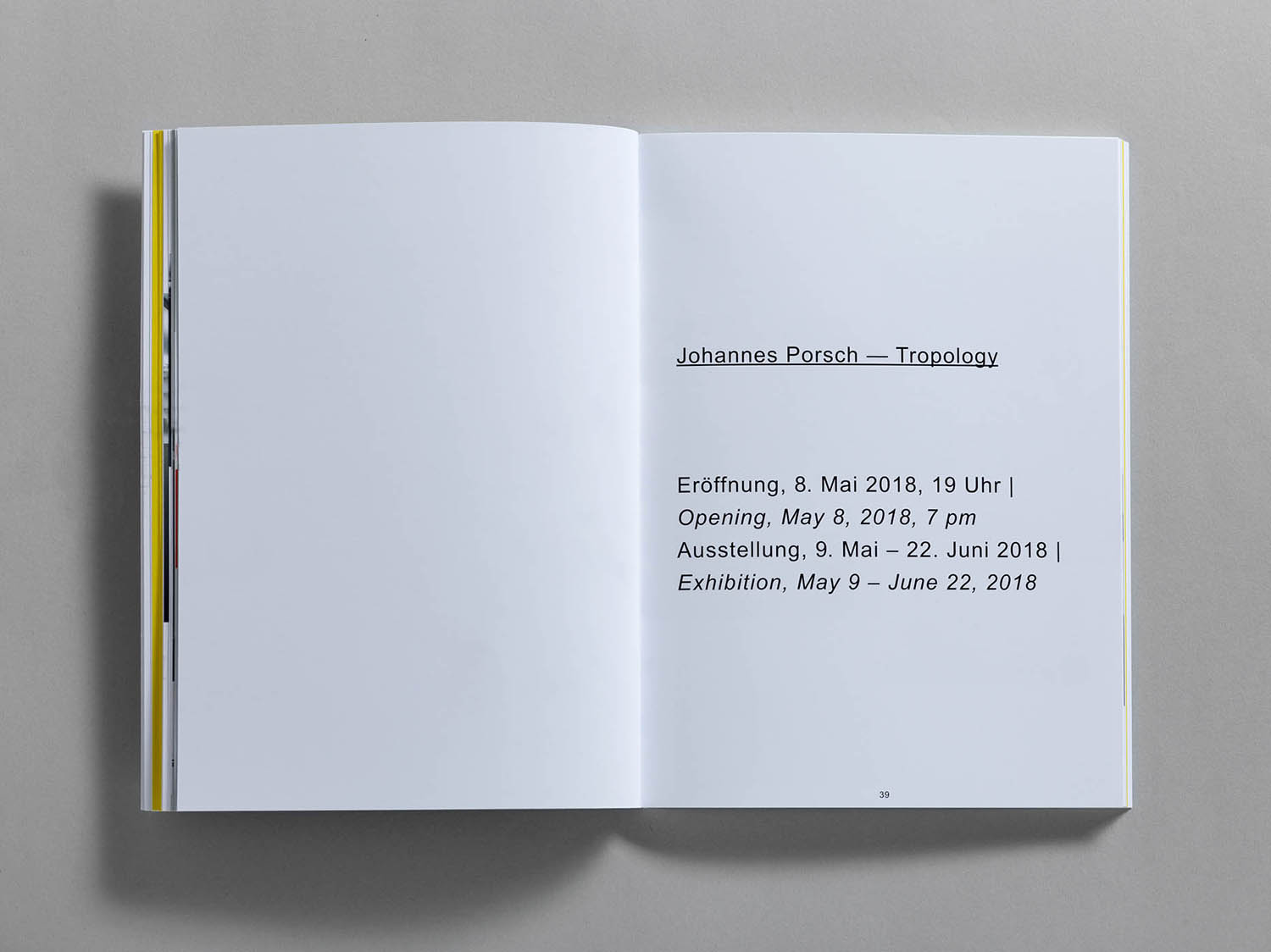Einige nützliche Begriffe für künstlerisches Forschen
Karin Harrasser
Es war einmal ein Märchen, das in den Büchern des globalen Nordens über Jahrhunderte hinweg wieder und wieder erzählt wurde. Es handelte davon, wie mutige Männer ihren eigenen Sinnen zu trauen lernten und die Sinne dabei verwandelten. Es gibt viele berühmte Szenen in dieser Geschichte. Eine davon ist der Auftritt René Descartes, der maskiert die Bühne der Philosophie betritt, die Schamesröte über den eigenen Auftritt, das Lampenfieber unter einer Maske verschwinden lässt, also körperliche Zeichen durch gemachte Zeichen überdeckt, und schon bald die menschlichen Dinge säuberlich in aktive und denkende res cogitans sowie passive und dumme res extensa sortieren wird. Auftritt des Gegenspielers: Gottfried Wilhelm Leibniz besteht ihm gegenüber darauf, dass es Übergangszonen zwischen Sinneswahrnehmung und Denken gibt. Ihn interessiert der Grenzverkehr zwischen der Materialität des Körpers und den luftigen Ideen, den kleinen Perzeptionen und den großen Gedanken. Währenddessen sitzen die Naturforscher der Royal Academy in einem Salon und hören den Holzwürmern zu. Thomas Hobbes und Robert Boyle debattieren über die Existenzbedingungen von Vakuum und Johannes Kepler kämpft um die Freilassung seiner Mutter Katharina, die der Hexerei bezichtigt wird. In dieser schnellen Montage sehen wir, wie die Sinne isoliert und gesteigert werden: zuerst mal stillsitzen, Apparate bedienen, durch Mikroskope und Fernrohre blicken, dann die ganze Welt ins Labor holen, die Forschungsgegenstände zerteilen, einschließen, vorsortieren; oder aber mit der Kamera in die Welt ziehen, eckige Ausschnitte von Welt heimholen, standardisieren. Es geht darum, immutable mobiles herzustellen, die Bifurkation der Natur nicht nur heuristisch anzunehmen, sondern technisch und erkenntnistheoretisch weiterzutreiben und, das, was dann Natur heißen wird, stetig zu verbilligen, zur Ressource, zum Handelsgut zu machen: Rohstoffe, Arbeitskraft, immer mehr auch human nature, Kognition und Affekt werden zur optimierbaren Ressource. Es gibt zwar immer wieder einmal Widerstand und Gegenstimmen, nicht zuletzt aus den Künsten, aber es geht recht lange munter weiter. Manchmal läuft das ganze aus dem Ruder, dann explodieren Bomben, space shuttles stürzen ab, Flüsse treten über die Ufer, riesige Gebiete werden atomar verstrahlt. Aber die Katastrophe verfügt über sublime Reize, erzeugt zwar Erregung, sonst passiert aber nicht viel. Im mittleren 20. Jahrhundert bildet sich eine Art philosophischer Guerilla-Organisation, Leute, die aus den Wissenschaften kommend an der modernen Wahrheitssuche festhalten, aber nun auch die Opfer der Wahrheitssuche zählen. Leute, die nachrechnen und meinen, der Preis der Wahrheit sei manchmal zu hoch; Leute, die nachfragen, ob nicht eine andere Forschung möglich wäre und die in den Ruinen der Aufklärung ein neues Stück zur Aufführung bringen wollen. Sie sind der Meinung, dass die Rollen neu verteilt werden müssen und sie sind überzeugt davon, dass nicht nur Menschen in dem zukünftigen Stück eine Rolle spielen werden, dass neue Sensibilitäten geschaffen werden müssen und dass die Aufführungsdauer des Stücks sehr viel länger sein würde, als die Fristen den Menschheitsgeschichte es vermuten lassen. Die erste Aufgabe besteht allerdings darin, der Erzählgemeinschaft, der wissenschaftlichen community, klar zu machen, dass die laufende Aufführung ein wirklichkeitsschaffendes Märchen ist, das von der Überlegenheit des globalen Nordens handelt. Ihre erkenntnistheoretischen Modelle sind: Märchenvernunft, Spekulationen gegen das Wahrscheinliche, situiertes Wissen, phantastische Genauigkeit.
Märchenvernunft
Siegfried Kracauer, der Filmkritiker und kritische Theoretiker, schrieb für das Abendblatt 19311 eine Rezension zu Albert Einsteins populärwissenschaftlichen Vorträgen über Physik. Wie ein Märchenonkel erschien ihm der Wissenschaftler, wenn er für sein überwiegend kindliches und weibliches Publikum über Physik sprach. Das klingt despektierlich, ist aber nicht negativ gemeint: Einstein mache das Publikum über Dinge staunen, die in der Alltagswahrnehmung völlig selbstverständlich wären, beobachtet Kracauer. Wir nehmen zum Beispiel einfach an, dass trockener Sand weich und nasser Sand hart wäre. Die Explikation der Formeln und Gesetze, die erklären, warum das so ist, führten aber keineswegs dazu, dass dieses blinde Vertrauen gestärkt würde. Ganz im Gegenteil: Die materielle Welt verwandle sich in ein höchst unwahrscheinliches Gebilde, alles würde in ein fragwürdiges Licht gerückt, man zittere unwillkürlich um den Fortbestand ihrer Existenz: „Das war nicht der Sand mehr, auf den man bisher gedankenlos getreten hatte, das war ein innerlich durchleuchteter Sand.“2 Einsteins Erläuterungen seien auf so fantastische Art einleuchtend, dass sie eine neue Wirklichkeit herbeizuzwingen in der Lage seien. Kracauer nennt das Märchenvernunft und führt aus: „hätten sie sich gleich dieser [der Märchenvernunft, KH] unversehens aus der Wirklichkeit entfernt: der Wirklichkeit wäre nichts anderes übrig geblieben, als ihr Folge zu leisten.“3 Der Boden gerät ins Rutschen, der Härtegrad der Wirklichkeit wird fraglich, und zwar nicht durch die Evokation einer Fantasiewelt, sondern durch kunstfertige wissenschaftliche Rhetorik, die in die Materie eindringt. Die Märchenvernunft ist es, die die Alltagswahrnehmung zu stören imstande ist. Kracauer vergleicht Einsteins Vortrag mit Kurd Laßwitz’ physikalischen Märchen, genauer mit seinem Märchen Seifenblasen, das 1887 erstmals publiziert wurde.4 Laßwitz, einer der Miterfinder des literarischen Genres der Science-Fiction, entwirft darin ein Szenario, in dem zwei Menschen durch einen Apparat (das Mikrogen) so weit geschrumpft werden, dass sie auf einer Seifenblase spazieren gehen können. Auch ihr sinnliches Vermögen verändert sich entsprechend: Ihre Zeitwahrnehmung passt sich der Seifenblasenwelt an, denn drei Sekunden in Erddimensionen dauern mehrere Millionen Jahre in der Seifenblasenwelt. Laßwitz verwendet filmische Mittel, nämlich den Zeitraffer, um die Relativität – oder sollte man besser sagen: Relationalität – von Zeit zu veranschaulichen. Die menschlichen Besucher der Saponier (der Seifenblasenmenschen) werden zunächst nicht ganz synchronisiert, sodass ihnen zunächst etwa das Wachsen einer Pflanze wie ein Springbrunnen erscheint. Erst als sie auf das Zeitmaß der Saponier beschleunigt sind, sehen sie die Abläufe in der Geschwindigkeit wie diese. Für die weiteren Abenteuer von Onkel Wenzel ist hier kein Platz, aber was mir wesentlich für Kracauers Faszination für dieses physikalische Märchen erscheint, ist die Provokation, die von Science-Fiction für die Wahrnehmung des Stabilitätsgrads von Wirklichkeiten ausgeht: Sich überhaupt vorstellen zu können, dass es eine andere Welt geben könnte, daran hält Kracauer als eine fundamentale Ressource der Künste und der Wissenschaften fest, wissend, dass die Qualifikation des saponischen Abenteuers als „Märchen“ die Wirksamkeit der Erzählung beschneidet, ja, sie sogar zur Stütze der Wirklichkeit, wie sie ist, machen kann. Die Besucher der Seifenblasen verlieren dann auf dem Rückweg auch noch ihre Mitschriften, sodass sie unglaubwürdig wirken und eben keine Kulturgeschichte der Saponier vorlegen können, sondern nur ein Märchen. Vielleicht lässt sich so auch Kracauers spätere Hinwendung zur Geschichte als science with a difference verstehen: Geschichtsschreibung, dieser Zwilling der Science-Fiction, ist laut Kracauer dazu imstande, in der Spannung aus Dokument und Erzählung die lost causes der Vergangenheit so zu rekonstruieren, dass ihre unrealisierten Potenziale zu einem zwingenden Argument werden, und nicht einfach eine Option unter vielen, analog zu Einsteins physikalischen Erklärungen, die die materielle Welt zwingen, ihre Härte aufzugeben. Das Märchenhafte alleine hat keinen zwingenden Charakter, da es routiniert ins Reich der Fantasie abgeschoben werden kann, die Vernunft alleine ist zu intim mit einem positivistischen Wissenschaftsbegriff verzwirbelt, als dass sie kritisch sein könnte.
Mit dem Begriff Märchenvernunft ist also ein bestimmtes Verhältnis von Fakten und Fiktionen, von Dokumentation und Fabulation angesprochen. Dieses Verhältnis beschäftigt Kracauer, wie schon angedeutet, in seinem posthum erschienenen Buch über Geschichtsschreibung5, wenn er dort auf das Verhältnis von der Verpflichtung des Rückgriffs auf Dokumente und dem Erzählen in der Historiografie eingeht. Gewährsleute für seine Geschichtsauffassung findet er nicht ausschließlich in der Historiker*innenzunft, sondern auch bei Filmemachern und Schriftstellern. Am prominentesten sind Proust und Kafka in dem Buch vertreten. Das Verhältnis von Fakten und Fiktionen, Dokumentation und Fabulation beschäftigt Kracauer bekanntlich auch in seiner Theorie des Films6. Film ist hier insofern märchenhaft, als er im Aufnehmen der physical reality selbst eine neue schafft. Dokumentation und Fiktion kommen im Film und in der Geschichtsschreibung so zusammen, wie in der Märchenvernunft Rationalität und Einbildungskraft im Zauberspruch: Ein Sprechakt, ein ästhetischer Akt, der Neuwahrnehmen und Neudenken der Wirklichkeit mit all ihren Zumutungen erzwingt.
Spekulationen gegen das Wahrscheinliche
Welcher Begriff des Spekulativen ließe sich der Märchenvernunft an die Seite stellen? Mein Vorschlag wäre, sich bei der belgischen Philosophin Isabelle Stengers kundig zu machen, die Spekulation so bestimmt: „dasjenige […], das eine Verpflichtung bzw. einen Zwang (contrainte) auferlegen wird, dasjenige, das das Denken verpflichten wird (qui va engager la pensée). Oder noch einmal in anderen Begriffen ausgedrückt, […] der Prüfstein der Spekulation ist nicht das Wahrscheinliche, sondern das Mögliche.“7 Beim Spekulieren in diesem Sinn geht es also nicht um die Extrapolation der Gegenwart oder um Wetten über wahrscheinliche Verläufe, sondern um eine retroaktive Treueprozedur, um eine Operation im Futur II: Das spekulative Denken muss sich an dem messen, was es an Möglichkeiten zum Erscheinen gebracht haben wird. Der Begriff „Verpflichtung“ (obligation, in der Gebrauchsweise von A.N. Whitehead) eröffnet eine Auffassung des Spekulativen, die wenig mit der Alltagsauffassung von Spekulation als realitätsferner Fiktion oder als etwas spontan und subjektiv Dahingesagtes zu tun hat. Spekulatives Denken interveniert vielmehr systematisch in eine Wirklichkeit, mit der sie verstrickt bleibt. Spekulieren ist kein abstraktes Überwinden von Problemen, die eine konkrete Wirklichkeit bereithält, sondern ist eine Verwicklung von Problem und Lösung, von Dingen und Wörtern (von Aktuellem und Virtuellem) und bezieht sich auf eine Wirklichkeit, die stets im Wandel begriffen ist, und folglich auf eine Zukunft, die unvorwegnehmbar ist. Das Spekulative in diesem Sinn hat eine imaginative Dimension und führt, wie schon die Märchenvernunft, science und fiction eng. An dieser Stelle sei an Michel Foucaults Bestimmung der Fiktion erinnert: Sie sei einerseits „die sprachliche Ader dessen, was so wie es ist, nicht existiert“8. Die Fiktion kennzeichnet also das, was ist, als etwas, das auch anders sein könnte. Andererseits bestimmt Foucault Fiktion als eine Art Abstandsmessung zwischen dem Äußeren und dem Inneren, der Welt und den Worten. In einer Zeit, in der an den Börsen mit Wahrscheinlichkeiten spekuliert wird, um die Gegenwart zu knebeln, steht mit einer ästhetisch-philosophischen Praxis des Spekulativen, mit Spekulationen auf das Unwahrscheinliche, das dem Möglichen in der Gegenwart verpflichtet ist, nicht wenig auf dem Spiel. Während die Spekulation auf das Wahrscheinliche auf eine schlechte Unendlichkeit des Immergleichen hinausläuft, geht es bei der Spekulation gegen das Wahrscheinliche um die Multiplikation von Gegenwarten, um die Vermehrung unwahrscheinlicher Möglichkeiten, um eine Öffnung des Horizonts. Stengers solidarisiert sich folglich mit Henri Bergsons Insistieren darauf, dass das Wirkliche das Mögliche schafft und nicht umgekehrt. Bergson arbeitet dies mit Blick auf die Kontingenz historischer Ereignisse aus. Als er einmal gefragt wurde, wie er sich die Literatur der Zukunft (nach dem Krieg) vorstelle, antwortete er, dass er sie selber schreiben würde, wenn er das wüsste. Später fällt die Antwort etwas systematischer aus:
In demselben Maß, wie die Wirklichkeit sich erschafft als etwas Unvorhersehbares und Neues, wirft sie ihr Bild hinter sich in eine unbestimmte Vergangenheit; sie erscheint so als zu jeder Zeit möglich gewesen, aber erst in diesem Augenblick beginnt sie, es immer gewesen zu sein, und gerade darum sage ich, daß ihre Möglichkeit, die ihrer Wirklichkeit nicht vorausgeht, ihr vorausgegangen sein wird, sobald die Wirklichkeit aufgetaucht ist. Die Wirklichkeit wirft ein Bild hinter sich, das erst die Vergangenheit entstehen lässt, die vergangene Wirklichkeit als eine Ressource unendlicher Möglichkeiten.9
Wirklichkeitsbeschreibung im Modus spekulativen Denkens wäre demnach die Praxis des Sichtbarmachens einer Wirklichkeit, die in der Gegenwart unwahrscheinliche Möglichkeiten vermehrt.
Situiertes Wissen
Moderne Wissenschaft erzwingt eine bestimmte Wahrnehmung von Wirklichkeit, nur tut sie so, als sei sie kein Zauberspruch, sondern ein, wie das Auge Gottes, über ihr schwebender Spiegel. So könnte man die Ausgangslage zusammenfassen, die Donna Haraways Essay Situiertes Wissen10 von 1988 zugrunde liegt. Den Effekten der Konstruktion dieses überblickenden Standpunkts und einer daraus abgeleiteten Beherrschbarkeit einer „passiven Natur“ wird in dem Essay die konkrete Involviertheit in eine historisch gewordene, asymmetrische Wissensordnung gegenübergestellt. Haraway argumentiert nicht für die Preisgabe wissenschaftlicher Tugenden, sondern für die Notwendigkeit der Begrenzung des Geltungsbereichs abendländischer Wahrheitsansprüche. Wahrheitsansprüche haben einen Preis, sie sind nicht billig. Der Aufsatz bleibt nicht beim Nachweis der Interessiertheit und Situiertheit angeblich uninteressierten Wissens stehen, sondern versucht eine Perspektive und Praxis zu gewinnen, die es erlaubt, skeptisch und kompetent mitzureden, wenn es um Fragen nach Wissenschaft und Technik geht. Haraways Plädoyer für eine Methode der Diffraktion, der „Beugung“ von wissenschaftlichem Wissen11 und für eine starke Objektivität in Form einer „partialen Perspektive“ hat jedoch als erste Bedingung die reflexive Miteinbeziehung der Entstehungsbedingungen von Wissen. Dies betrifft epistemologische Vorannahmen, institutionelle und ökonomische Interessen, Medien und Techniken der Erkenntnisproduktion, aber auch die Darstellungsformen (Bilder und Erzählungen) von Wissen. Haraway entwickelte diese Erkenntnishaltung in einer Absetzbewegung zum god trick abendländischer Wissenschaft, also der Ablösung der Beobachter*innenposition aus ihren diskursiv-materiellen Verstrickungen, und macht stattdessen Multiperspektivität, Interessiertheit, Positioniertheit, ja Parteilichkeit, stark. Situiertes Wissen und Partialität der Perspektive impliziert, sich über die eigenen Verstrickungen mit abendländischen Ordnungen des Wissens Klarheit zu verschaffen. Um die Historizität der eigenen Perspektive zu wissen, ist jedoch nicht Relativismus, sondern Relationalität und Selbstbeschränkung. Situiertheit erfordert die Explikation der Partialität jedes forschenden Blicks und eröffnet einen Weg, um – ähnlich wie die zeitgleich in Paris entstehende Actor-Network-Theory – Objekte der Forschung als eigensinnige, beteiligte Akteure zu denken. Situiertheit erfordert auch, sich echten Problemen zu widmen, die in der konkreten Situation pragmatisch wichtig sind und für die es zwar (auch) wissenschaftliche, aber keine unumstrittenen Lösungen gibt. Das Ergebnis solcherart Wissenschaft kann dann auch (wiederum) Science-Fiction sein, zumindest aber eine Wissenschaft, die ihre fiktionalen und narrativen Elemente mitdenkt; oder auch „slow science“, eine Wissenschaft der Interpretation, der Übersetzungen, des Stotterns, ein dichteres Gewebe des Wissens, oder auch, wie Haraway schlicht sagt: eine bessere Wissenschaft.
Was jedoch bedeutet eine partiale Perspektive in einer Welt, in der lokale Probleme systematisch mit globalen Dynamiken verstrickt sind? Lokale Problemlagen sind schließlich von überregionalen, ökonomischen und wissenschaftlich-technischen Prozessen mitproduziert und können deshalb nicht lokal gelöst werden. Ein prominentes Beispiel dafür ist die immer stärkere Vernutzung der Regenwälder, um einen globalen Markt an Öl, Sojabohnen und Essstäbchen zu bedienen. Werden globale Verantwortlichkeiten von der regionalen Politik benannt, führt dies derzeit (noch) zu Verstörung auf dem Parkett der internationalen Politik, etwa als Ecuador internationale finanzielle Beteiligung bei der Bewahrung des Yasuní-Nationalparks vor der Ölindustrie forderte. So gut wie alle aktuellen wissenspolitischen Streitfälle – ließe sich zugespitzt sagen – sind ähnlich strukturiert: Globale technowissenschaftlich-ökonomische Verhältnisse produzieren lokal Unverhältnismäßigkeiten und Asymmetrien, die politisches Handeln provozieren, im Zuge dessen heterogene Wissens- und Kommunikationsformen mobilisiert werden. Haraway spricht deshalb explizit von situierten, lokalisierten und gleichzeitig erdumgreifenden Projekten, die eine gemeinsame Welt erzeugen, die aber immer nur partiell eine geteilte sein wird.12 Situiertes Wissen zu generieren impliziert damit ein Sensibilisierungsprojekt, das dem Immunisierungsprojekt der modernen Wissenschaft entgegensteht: Sensibel werden für Machtverhältnisse, für die eigenen blinden Flecken und Ignoranzen, für historisch gewordene Ausschlüsse, für Unvereinbarkeiten, für schwer greifbare Akteur*innen, für im Entstehen begriffene gemeinsame Teilwelten. Dass die Genres und Medien der Natur- und Geisteswissenschaften in ihrer Restriktion auf nur wenige Kanäle, legitime Erkenntnismodi und Agentien dafür nicht ausreichend sind, ist naheliegend, weswegen sich Haraway in ihrem letzten Buch nicht nur für dekoloniale künstlerisch-aktivistische Projekte stark macht, sondern auch selbst anfängt, Science-Fiction-Geschichten über artenübergreifende Verwandtschaftsbeziehungen zu schreiben.13 Poiesis, Welterzeugung, ist ein wissenschaftliches Projekt, das man nicht den Wissenschaftler*innen alleine überlassen sollte, denn deren Erkenntnisinstrumente reichen nicht weit genug, um die kaskadierenden Effekte wissenschaftlichen Handelns auch nur annäherungsweise erfassen zu können. Den Künsten kann hier keine Assistenz- oder Kompensationsfunktion zukommen, sie müssen vielmehr selbstbewusst für ihre situierte Vorgehensweise als bessere Wissenschaft streiten.
Phantastische Genauigkeit
Im Vorgehen erinnert einiges bei Haraway an eine Methode, auf die sie sich – wenig überraschend – nicht bezieht. Robert Musil nennt sie im Mann ohne Eigenschaften „phantastische Genauigkeit“14. Er setzt diese von der „pedantischen Genauigkeit“, etwa der Gerichte, mit ihren lang eingelagerten und immer und überall reaktivierbaren Wahrheiten (auch das: immutable mobiles) ab, aber auch vom reduktionistischen Vorgehen der Mathematophysik. Im Kontrast dazu wird im Mann ohne Eigenschaften der Möglichkeitssinn als genuin künstlerische Methode entwickelt. Der Möglichkeitssinn ignoriert dabei ebenso wenig wie Märchenvernunft und situiertes Wissen die Wirklichkeit und die Fakten, sondern baut eine andere Beziehung zu ihnen auf, eine Beziehung, in der die Ziele und Wege des Handelns sich multiplizieren, auffächern, unübersichtlich werden und Verengungen und Sachzwänge sich als gemacht herausstellen.15 Die „pedantische Genauigkeit“ folgt – so Musil – ihrerseits Fantasiegebilden, da sie dem Missverständnis unterliegt, dass sich Menschen rational, also sich selbst transparent verhielten.16 Der Möglichkeitssinn meint aber noch mehr als die Einbeziehung strategisch ausgeblendeter oder subjektiver Motivationen in das Kalkül der Handlungen. Er erfindet alternative Hirngespinste, um die angebliche „Wirklichkeit“ neu zu bewerten, um in ihr noch nicht entdeckte Möglichkeiten aufzuspüren. Der Möglichkeitssinn ist demnach nicht einfach Fischen im Trüben. „Der Mann mit gewöhnlichem Wirklichkeitssinn“, so Musil in der berühmten Stelle, „gleicht einem Fisch, der nach der Angel schnappt und die Schnur nicht sieht, während der Mann mit jenem Wirklichkeitssinn, den man auch Möglichkeitssinn nennen kann, eine Schnur durchs Wasser zieht und keine Ahnung hat, ob ein Köder daran sitzt.“ Die Zielgerichtetheit und angebliche Faktizität des „auf den Köder beißenden Lebens“17 tauscht Musil gegen eine konkrete, raumgreifende und raumstrukturierende – wenn auch zunächst erratische oder poetische – Praxis. Und genau deshalb ist das Verfahren der „phantastischen Genauigkeit“ den Tatsachen treuer als schlichte Sachlogik. Sie ist ein reicheres Verfahren, da sie über einen positivistischen Objektivitätsbegriff hinausgeht, indem sie die Realität der menschlichen Imaginationskraft mitbedenkt und all ihren Seiteneffekten Rechnung trägt.18
Sensibilisierung
Mit Märchenvernunft, Spekulation gegen das Wahrscheinliche, situiertem Wissen und phantastischer Genauigkeit sind also kulturwissenschaftlich-historische und künstlerisch forschende Wissenspraktiken angesprochen, die sich über ihre eigenen Möglichkeitsbedingungen aufklären und sich mehr oder weniger behutsam ins Fiktionale und Spekulative erweitern. Es sind Verfahren der Auffächerung und Komplizierung, die immer weiter fragen: nach Erkenntnisinteressen und -bedingungen, nach Verfahren, Medien und Haltebedingungen, dem Geltungsbereich, den Darstellungsformen des Wissens. Wie immer man das Ergebnis eines systematischen Zweifels an der Stabilität von Wissen und Wirklichkeit nennen möchte, der sich mit Vorschlägen für eine andere Welt in der gegebenen paart, mit einer solchen Haltung geht ein Verfahren der Sensibilisierung für die organisierte Form von Wissen, für Darstellungsformen, Erzählungen, Bilder, Diagrammatiken, Überzeugungsstrategien einher. Die neuzeitlichen Wissenschaften haben im Konzert der Visionen von Welt nicht zuletzt aufgrund ihrer vielfältigen Visualisierungstechnologien und überzeugenden Narrative äußerst wirkmächtige Formen der Darstellung entwickelt, die jedoch auf dem Weg ihrer rhetorischen oder formalen Analyse als historisch voraussetzungsvoll und an bestimmte Körper gebunden kenntlich gemacht werden können. Dies leisten nicht nur die Wissenschaftsgeschichte und die Kulturwissenschaft, sondern das leisten auch die Künste, wenn sie konventionalisierte Formen des Zeigens und Erzählens aufbrechen und durch die Exponierung der Form für die Gemachtheit der Aussagen sensibilisieren.
Ein märchenhafter, zeitgenössischer Dokumentarfilm scheint mir dieses Programm konsequent zu verfolgen. Die Filmtrilogie 1001 Nacht von Miguel Gomes von 2015 beschäftigt sich mit dem Neoliberalismus in Portugal; mit der Immobilienkrise, der steigenden Arbeitslosigkeit, dem Umgang mit Geflüchteten und mit dem Zerbröckeln sozialstaatlicher Institutionen. Sie berichtet über die Verluste, über Kriegsgewinnler, über Trauer und Hoffnung, indem sie die Märchen aus Tausendundeine Nacht mit dokumentarischem Material zusammenfügt. Zum einen tauchen in den Geschichten über Werftmitarbeiter, Fabrikarbeiterinnen und Dorfgemeinschaften an unwahrscheinlicher Stelle Fabelfiguren, Turbane und orientalisierende Kostüme auf; zum anderen sind die Lebensgeschichten der Porträtierten narrativ als Fabeln aus Tausendundeine Nacht gerahmt. So etwa eine Szene in Teil 2 – Der Verzweifelte, die mit „Die Tränen der Richterin“ überschrieben ist. Es handelt sich um eine in einem Amphitheater inszenierte Gerichtsszene, die einen vermeintlich einfachen Fall zum Inhalt hat: Eine Familie hat Möbel verkauft, die zum Inventar einer angemieteten Wohnung gehören, und wird daraufhin vom Wohnungseigentümer verklagt. Die Mutter bekennt sich sofort schuldig, aber dennoch entspinnt sich aus dem Vorfall eine komplizierte Geschichte über die Verwicklungen zwischen situierten Existenznöten und dem globalen Finanzkapital. Bei einem chinesischen Investor, vertreten durch seinen Anwalt, läuft einiges zusammen, aber auch er hat keine „Schuld“, sondern hat nur Investitionsoptionen wahrgenommen, die die portugiesische Regierung offeriert hat. Ein Dschinn tritt auf, dessen Intervention die Sache eskalieren hat lassen, und am Ende hängt alles an einer alleinerziehenden taubstummen Mutter, der 140 Euro gestohlen worden sind und die sich deshalb gezwungen sah, sich illegal Geld zu besorgen. Der Dieb der 140 Euro hat jedoch eine Notiz hinterlassen, auf der er sich entschuldigt und um Verständnis wirbt: Jede/r brauche doch Geld und man bekäme es immer nur auf Kosten anderer.
Mir scheint, dass diese Art des Erzählens mehr Realität ans Licht bringt als realistisches Erzählen, nämlich die Wirkungskreisläufe der unendlich vielgestaltigen und so schwer darstellbaren Verflechtungen von Reichtum und Elend, die unsere Gegenwart prägen. Nur die Märchenvernunft hat genügend Einbildungskraft, um sich den Realitätsdruck der verzweigten, unsichtbaren, brutalen Kräfte des globalen Kapitals im 21. Jahrhundert am Werk vorzustellen. Eine Märchenvernunft, die über ihre Anderen (die instrumentelle Vernunft genauso wie das, was als Unvernunft denunziert wird) Bescheid weiß, muss aber ergänzt werden durch Märcheninstitutionen (im Film ein Gericht, das Pferde anhört), die über ihr Anderes wissen (also über ihre Machteffekte), aber doch verlässlich sind, anrufbar bleiben. Es geht dabei auch darum, nicht dem Kapital, dem großen Verflüssiger, die Veränderung der Welt zu überlassen.
Märchenvernunft und Märcheninstitutionen können aber noch fantastischer, glamouröser und wilder ausfallen. Thomas Pynchons Gegen den Tag19 handelt nicht zuletzt von der eigentümlichen Zeitlichkeit des 21. Jahrhunderts. Das Luftschiff Inconvenience mit seiner Besatzung, zu der u.a. ein philosophierender, sprechender Himmelshund gehört, kann auf dem Licht durch die Zeit reisen und so manchmal Schlimmstes verhindern. Nach 1500 Seiten Western, Erfinderroman, Pornografie, Weltkriegsdrama verbündet sich die Mannschaft der Incovenience mit einer Gruppe kämpferischer Frauen. Unter dem Motto „Anwesend, aber unsichtbar“ bündeln sie ihre Kräfte, um fortan gemeinsam für das Gute zu kämpfen. Es wird viel gefeiert und gevögelt, ein für menschliche Augen unsichtbares, egalitäres Gemeinwesen entsteht auf der Inconvenience, die bald einer fliegenden Stadt gleicht. Die intergalaktischen und transtemporalen Abenteuer begreift diese buntgescheckte Truppe als Pilgerfahrt, sie ist auf der Suche nach dem unbeabsichtigten, selbstlos gewährten Guten, nach grace. Das zeigt sich zwar nirgendwo, aber die crew ist ganz sicher, „dass es irgendwo ist, wie ein heranziehender Regensturm, nur unsichtbar. Bald werden sie bemerken, dass die Messgeräte einen Druckabfall anzeigen. Sie werden spüren, dass der Wind sich dreht“.20 Die Zukunft ist schon anwesend, aber unsichtbar.
Mein Vorschlag ist deshalb, künstlerisches Forschen als sowohl problemzentriert als auch als fantastisch und situiert zu konzipieren. Problemzentriert im Sinne Donna Haraways Credo Staying with the Trouble. Troubles, die Probleme des 21. Jahrhunderts, sind so vielschichtig und weitverzweigt, dass es unausweichlich ist, sie von verschiedenen Seiten anzugehen und ihre medialen und ästhetischen Verfasstheiten genauso mitzudenken wie ihre technowissenschaftlichen und kolonialen Verstrickungen. Die Probleme müssen auch in dem Sinn situiert werden, dass es notwendig ist, ein Bewusstsein dafür wachzuhalten, dass wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Wissensformen zwar nicht völlig unvereinbar, aber aus historischen Gründen unterschiedlich bewertet sind (zum Beispiel, indem in Wissen und Glauben sortiert wird) und deshalb konstant auf ihre Wirkungskreisläufe hin befragt werden müssen. Künstlerische Forschung bedeutet für mich aber auch, spekulativ in dem Sinn zu sein, dass in der Untersuchung eines Problems ein Sensorium für im Entstehen begriffene Subjektivierungen und Agentien entwickelt wird. Denn die Wissenschaften und die Künste des 21. Jahrhunderts werden relational, nicht relativ gewesen sein und sie werden weiterhin Tricks erfinden, um die Welt vor unseren weit geöffneten Augen in eine andere zu verwandeln. Zum Guten wie zum Schlechten.
Veröffentlicht in
Franz Thalmair (Hg.): Kunstraum Lakeside — Recherche | Research,
Verlag für moderne Kunst: Wien, 2019.
Download
1 Vgl. Kracauer, Siegfried: „Außerhalb der Universität“, in FZ 2.10.1931, in Werke in neun Bänden. Band 5.3: Essays, Feuilletons, Rezensionen, hg. v. Inka Mülder-Bach, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2011.
2 Ebd., 657.
3 Ebd.
4 Vgl. Laßwitz, Kurd: Seifenblasen. Moderne Märchen, Düsseldorf: ULB 1890.
5 Vgl. Kracauer, Siegfried: Geschichte. Vor den Letzten Dingen, übers. v. Karsten Witte, Vorwort von Paul Oskar Kristeller, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1973.
6 Vgl. Kracauer, Siegfried: Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1964.
7 Den Hinweis auf dieses Zitat und Stengers’ Konzeption des Spekulativen verdanke ich Katrin Solhdju, die das Zitat auch übersetzt hat. Es lautet im Original: „Il s’agit de déterminer ce qui va faire contrainte, ce qui va engager la pensée. En d’autres termes encore, et c’est pourquoi il faut parler de spéculation, la pierre de touche n’est pas le probable, ce qu’autorise l’état des affaires aujourd’hui […]. Ce qui oblige à penser est le possible, […] ce qui oblige donc à se créer capable de résister au probable.“ Stengers, Isabelle: „Un engagement pour le possible“, in Cosmopolitiques 1 / 2002, 27–36.
8 Michel Foucault: „Distanz, Aspekt, Ursprung“, in Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits, Bd. I. 1954–1969, hg. v. Daniel Defert, François Ewald und Jacques Lagrange, Frankfurt a. M.: Surkamp 2001, 370–387, hier: 381.
9 Bergson, Henri: „Das Mögliche und das Wirkliche“, in Denken und schöpferisches Werden, Maisenheim a. d. Glan: Westkulturverlag 1948, 110–124, hier: 121.
10 Haraway, Donna: „Situiertes Wissen. Die Wissenschaftsfrage im Feminismus und das Privileg einer partialen Perspektive“, in Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen, hg. u. eingel. v. Carmen Hammer, Immanuel Stieß et al., Frankfurt a. M.: Campus 1995, 73–97.
11 Vgl. Deuber-Mankowsky, Astrid: „Diffraktion statt Reflexion. Zu Donna Haraways Konzept des Situierten Wissens“, in Zeitschrift für Medienwissenschaft 4 / 2011, 83–91.
12 Vgl. Haraway, Donna: „The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others“, in Cultural Studies, hg. v. Lawrence Grossberg, Cary Nelson und Paula Treichler, London: Routledge 1991, 183–201.
13 Vgl. Haraway, Donna: Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän, übers. v. Karin Harrasser, Frankfurt a. M.: Campus 2018.
14 Vgl. dazu ausführlich: Harrasser, Karin: „Treue zum Problem. Situiertes Wissen als Kosmopolitik“, in Situiertes Wissen und regionale Epistemologie. Zur Aktualität Georges Canguilhems und Donna J. Haraways, hg. v. Astrid Deuber-Mankowsky und Christoph Holzhey, Wien/Berlin: Turia & Kant 2013, 241–259.
15 Vgl. Vogl, Joseph: Über das Zaudern, Berlin/Zürich: Diaphanes 2007, 56f.
16 Musil, Robert: Der Mann ohne Eigenschaften I, Reinbek: Rowohlt 1987, 247.
17 Ebd., 17.
18 Ebd., 247.
19 Vgl. Pynchon, Thomas: Gegen den Tag, übers. v. Nikolaus Stingl und Dirk van Gunsteren, Reinbek: Rowohlt 2008.
20 Ebd., 1596.