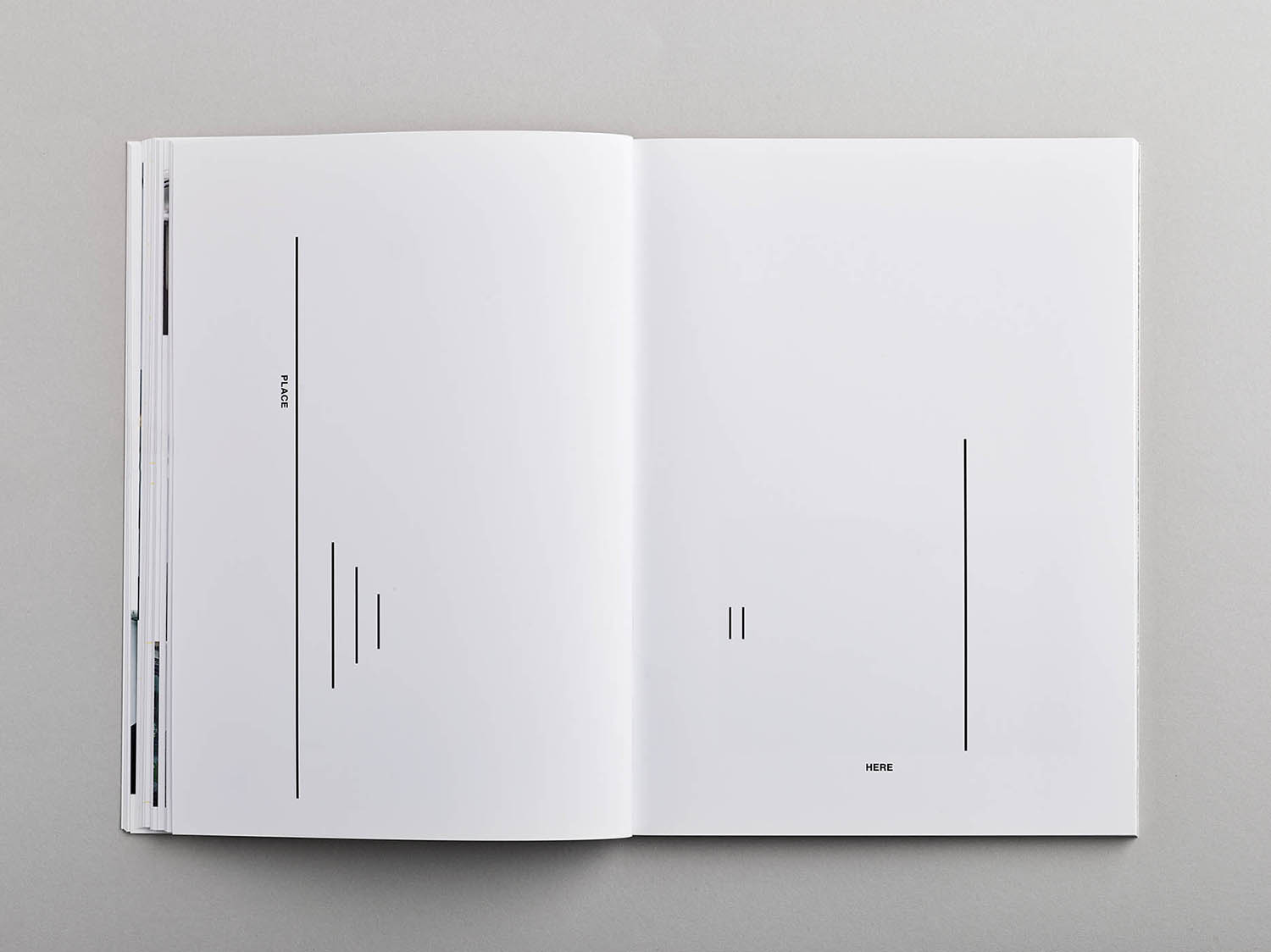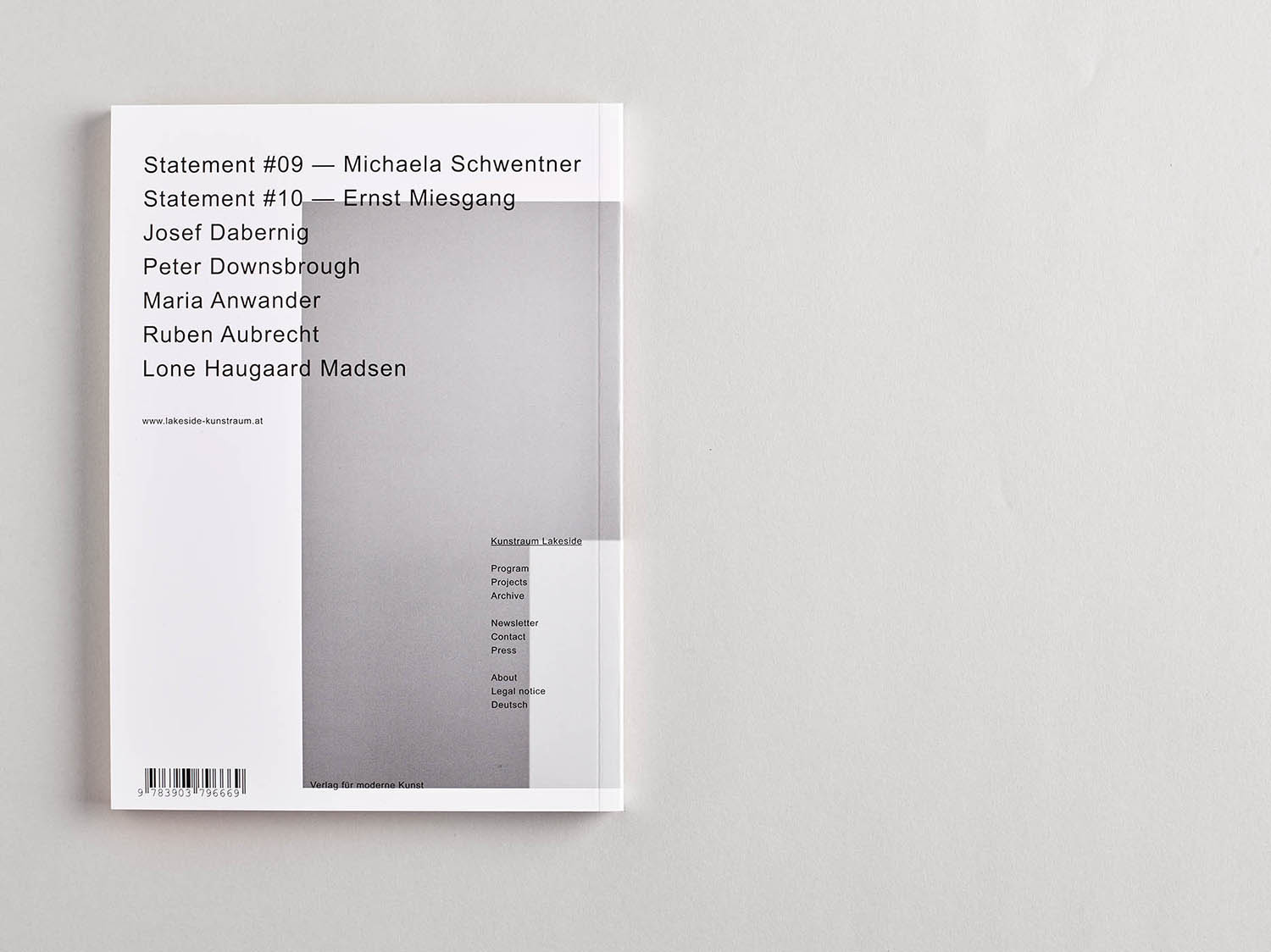Simon Sheikh
Der Terminus Dispositiv bezeichnet also etwas, in dem und durch das ein reines Regierungshandeln ohne jegliche Begründung im Sein realisiert wird. Deshalb schließen die Dispositive immer einen Subjektivierungsprozeß ein, da sie ihr Subjekt selbst hervorbringen müssen.1
– Giorgio Agamben
Formate sind dynamische Mechanismen zur Aggregation von Inhalten. In Medien überschneidet sich ein materielles Substrat (etwa Farbe auf Leinwand) mit einer ästhetischen Tradition (etwa der Malerei). Am Ende führen Medien zu Objekten, also zur Reifikation. Formate sind ihrem Wesen nach verknüpfte Netze und differenzielle Felder, die ein unberechenbares Gemisch von ephemeren Strömen und Ladungen mit sich tragen. Es handelt sich um Beziehungsgefüge von Kräften und nicht um diskrete Objekte. Kurz, Formate erzeugen Muster von Verbindungen oder Links.2
– David Joselit
In Michael Winterbottoms Film 24 Hour Party People aus dem Jahr 2002, der den Aufstieg und Untergang des legendären Musiklabels Factory Records nachzeichnet, gibt es eine Szene über die Aufnahme von Joy Divisions Debütalbum, in welcher die Band und Labelchef Tony Wilson einem Playback der Session lauschen. Wilson schlägt vor, ja besteht sogar darauf, sich den Track lieber im Auto statt im hochmodernen Tonstudio anzuhören, obwohl einer der Bandgitarristen wohl zu Recht protestiert, dass der Klang im Auto doch nur „Mist“ sei. Wilson stimmt zu, bekräftigt aber, dass man jedenfalls abwarten sollte, wie das Stück auf einem Transistorradio klingt. Worauf Wilson hier natürlich hinauswill, ist, die Perspektive weg von den Produzent*innen auf die Konsument*innen zu lenken und dabei gewissermaßen den Raum der Produktion, des Studios, zu verlassen und sich über die Methoden der Zirkulation – wie eben dem Autoradio (oder der Audiokassette) – der Rezeptionsapparatur des Transistors (in diesem Fall der billigsten und technisch simpelsten Version eines Soundsystems) zuzuwenden. Anstatt das Musikstück in all seinen akustisch ausgefeilten Details zu hören, besteht die Übung daraus, seinem Klang an sich – und damit seiner Botschaft in die Welt – nachzuspüren, und zwar auf Grundlage der Formatierung für seine Übertragung und Rezeption.
Die besagte Szene spielt im Jahr 1979, also in einer Zeit, als Musik vielfach über Transistoren und das Autoradio erlebt wurde bzw. durch die Formate der Vinylplatte oder Audiokassette, zwei nunmehr beinahe historische Musikträger, die jedoch bald an vorderster Front eines anhaltenden Krieges der Formate innerhalb der Musikindustrie zu liegen kamen, der sich im Laufe der 1980er-Jahre in der Schlacht Compact Disc gegen Musikkassette oder Langspielplatte und später im Angriff der MP3-Dateien auf die CD, Spotify versus Radio und so weiter, fortsetzen sollte. Im Wesentlichen spielten sich diese Kriege der Formate an drei Frontlinien ab: Ertrag, Wiederholung und Begehrlichkeit. Der Ertrag hat mit Gewinnmaximierung zu tun, etwa durch Reduktion der Produktionskosten pro Einheit, wie im Vergleich zwischen CD und Vinylplatte, bei gleichzeitiger Erhöhung des Stückpreises. Dies hat aber wiederum mit Wiederholung zu tun, indem die Konsument*innen dazu verleitet werden, dasselbe Musikstück auch so oft zu kaufen, wie sich dessen Formate ändern, und natürlich ebenso in Form von neu verpackten Werksammlungen, zum Beispiel verschiedensten Boxset-Editionen. Was uns zur dritten Front führt – der Begehrlichkeit: Dass die Konsument*innen dieselbe Musik doppelt oder öfter erwerben, hat nicht nur mit Bequemlichkeit zu tun, wie das Herunterladen unserer Lieblingsstücke auf das Smartphone und ähnliche Gerätschaften, sondern auch mit einem ultimativen Warenfetischismus, der sich bei der exklusiven Werkausgabe unserer Lieblingskünstler*innen ebenso zeigt wie im ästhetischen Genuss und Statusbewusstsein beim Sammeln, ob nun von Vintage- und Erstpressungen oder neuen Vinylschallplatten. In all diesen Fällen ist zwar das Medium immer das gleiche, nämlich (Pop)musik – und auch dessen Form bleibt als Single und Album im Sinne eines Artefakts und Inhalts im Wesentlichen unverändert – jedoch bestimmen die Varianten des Formats nun selbst, wie Musik auf- und wahrgenommen wird, wie und wo diese Begegnung und Erfahrung stattfindet, in quantitativer wie auch qualitativer Hinsicht.
Formate und (Post)medien
Die Formatkriege in der Musikindustrie (die eigentlich eine Art Bürgerkrieg waren, der beinahe die Industrie selbst zerstörte) können sicherlich dabei helfen, über Formate innerhalb der Parameter der zeitgenössischen Kunst nachzudenken, einschließlich ihrer Mechanismen der Produktion, Präsentation und Verbreitung, und dabei auch ihre etablierten Formen und Medien in Hinblick auf den Input und Output als dem Format-Begriff innewohnende Faktoren neu zu überprüfen. Zudem sind Ertrag, Wiederholung und Begehrlichkeit wichtige Aspekte, wenn man verstehen will, wie Kunst heute kommuniziert, in Umlauf gebracht und eben auch konsumiert wird (von Besucher*innen der Galerien bis zu echten Kunstsammler*innen). Während aber Formate im Kontext der Verbreitung von Musik als Produkt noch eine gut nachvollziehbare Form und recht klar definierte Bedeutung aufweisen, bringt uns ihr Einzug in die Kunsttheorie und -geschichte unversehens in die Nachbarschaft der modernistischen Debatte um die Form bzw. Form gegen Inhalt sowie in das umstrittene Territorium des Formalismus – worin jeweils dem Format einmal eine erweiternde, dann wieder dekonstruktive Kraft zugesprochen wird, ohne einer absehbaren finalen Schlussfolgerung!
Die Einführung des Begriffs Format in die zeitgenössische Kunsttheorie verdanken wir dem Kunsthistoriker David Joselit und seinem 2013 [in englischer Originalfassung] erschienenen Buch mit dem bezeichnenden Titel Nach Kunst, der schon andeutet, dass etwas vergangen ist, sich transformiert hat, nämlich die Kategorie der Kunst selbst. In diesem Sinne folgt das Buch dann auch einer Denktradition über die diversen Enden bestimmter modernistischer Ideen von Kunst, am wohl bekanntesten gefasst in Arthur C. Dantos Das Fortleben der Kunst aus 1998 [in englischer Originalfassung], auf dessen Titel Joselit anspielt, aber auch in aktuelleren Publikationen wie Joshua Decters Art Is a Problem und Pamela M. Lees Forgetting the Art World aus 2013 bzw. Ende 2012, also fast dem gleichen Zeitraum.3
Für Danto ist es der Doppelangriff in Gestalt des Readymades und des dematerialisierten Kunstobjekts durch die Konzeptkunst der 1960er- und 1970er-Jahre, der zum Ende der Kunst in einem historischen, linearen Sinne führt, während Joselits „Nach Kunst“ eine weniger spezifisch postmoderne Geschichte zeichnet und stattdessen beim Ende der Postmoderne sowie dem grundlegenden Wandel in der Produktion und, noch wesentlicher, der Zirkulation von Kunst, ansetzt, den die digitale Revolution mit sich brachte:
Das Nach im Buchtitel soll, anders als das Präfix post in Dantons bevorzugtem Begriff posthistorisch, sowohl die Auswirkungen der Bilder bei ihrer Verbreitung (wie im Wort Nachbild) als auch die Zirkulationsmuster, die auftreten, nachdem Bilder in Netzwerke eingeschleust wurden, indizieren.4
Wir haben es also mit zwei sehr verschiedenen, wenn auch (zugleich historisch) verwandten Vorstellungen über ein solches Nach zu tun: Erstere als ein Zu-Ende-Gehen der Kunstgeschichte, wenn nicht der Geschichte überhaupt, wohingegen die spätere, auf das Nachkommende eingehende Betrachtung sich eher mit einer Umwandlung statt mit dem Ende einer Ära beschäftigt, indem gefragt wird, was geschieht, wenn Bilder (der Kunst) digital transferierbar werden, und der Fokus dabei auf den Nachwirkungen dieser Veränderung, also dem, was nach diesem Ende kommt, liegt. Es geht, mit anderen Worten, nicht um postmediale, sondern um Verhältnisse im Post-Internet und daher um die Differenzierung mittels Formatierung und Vernetzung, welche den Schwerpunkt in der kunstgeschichtlichen Bildanalyse von der Produktion in Richtung Zirkulation und Rezeption verschiebt – eine Überlegung also, die Joselit mit der „Wirkung“ von Bildern umschrieben hat, und auch, wie er hinzufügt, deren Macht, deren inhärente Machtgefüge bzw. Beziehungen zu ihr. Diese Verschiebungen divergieren nicht nur in zeitlicher, sondern auch materieller Hinsicht: Während sich das Ende der Kunst auf die Auflösung der Form bezog, meint der „Nach Kunst“-Begriff sowohl das dematerialisierte Kunstobjekt als auch die Neukomposition des Bildes in der Kunst nach der Digitalisierung, also die Einführung des Formats in Nachfolge der Form.
Diskurswandel nach dem Internet
Diese Perspektivenwechsel transformieren sowohl das System als auch den Diskurs der zeitgenössischen Kunst in ihren unterschiedlichen Zeitläufen und Wirkungen, aber auch ausgehend von sehr verschiedenen Zugangspositionen (oder „verknüpften Netzen“, um Joselits bevorzugten Ausdruck zu verwenden). Es wäre an dieser Stelle sicherlich hilfreich, sich an Michel Foucaults Beschreibung in Über den Willen zum Wissen zu erinnern, wie radikale Veränderungen von diskursiven Praktiken sich in jeweils einer von drei spezifischen Weisen vollziehen:
Die Veränderung diskursiver Praktiken ist mit einem ganzen und vielfach komplexen Ensemble von Veränderungen verbunden, die außerhalb dieser Praktiken (in den Produktionsformen, den sozialen Beziehungen, den politischen Institutionen) stattfinden können oder in ihnen (in den Techniken zu [sic!] Bestimmung der Objekte, in der Verfeinerung und Anpassung der Konzepte, in der wachsenden Information) oder auch neben ihnen (in anderen Diskurspraktiken).5
Foucault hatte wohl hauptsächlich die Wissenschaften, inklusive der Geisteswissenschaften, und weniger das Schaffen und Vermitteln von Kunst sowie die Kulturproduktion als diskursive Formation vor Augen; bezieht man jedoch auch die zeitgenössische Kunst auf einer systemischen Ebene mit ein, wird der Unterschied zwischen den jeweils von Danto und Joselit erkannten Transformationen – und damit der Unterschied zwischen Medium und Format – besser verständlich. Was Danto am dematerialisierten Kunstobjekt „störte“ und für ihn zu einem gewissen Grad das Ende der Kunst einleitete, ist, dass er darin deutlich eine künstlerische Praxis ausmacht, die einen Wandel des Kunstdiskurses innerhalb der Disziplin selbst hervorbringt. Was Joselit hingegen als das „Nachbild“ und als Primat der Zirkulation in der Gegenwartskunst erfasst hat, vollzieht sich durch die technischen Fortschritte in der Bildproduktion im Zuge der Digitalisierung – mit anderen Worten, innerhalb einer diskursiven Formation in Form von neuen Technologien, die parallel zur zeitgenössischen Kunst laufen, ihr aber keineswegs fremd sind. Überdies ist auch eine Verschiebung des Fokus vom Kunstobjekt hin zur Zirkulation von Bildern feststellbar – und wo Medien unweigerlich zu Objekten, ja sogar Waren führen, erzeugen Formate nun als „Beziehungsgefüge von Kräften […] Muster von Verbindungen oder Links“, sie zirkulieren schließlich genauso als Währung wie als Ware und werden in diesem Sinne Teil einer globalen Ökonomie der Aufmerksamkeit.6
Indem Joselit sich darauf konzentriert, wie das bearbeitete, zirkulierende und reproduzierte Bild Konnektivität herstellt, auf unmittelbarer wie auch auf größerer, planetarischer Ebene, verfolgt er eine Vorstellung vom Bild, das in den sozialen (und politischen) Raum vorgedrungen ist und sich auch materiell durch die Pixelierung reorganisiert hat, was es ihm erlaubt, sich fortzubewegen und Anschlüsse herzustellen. Obwohl nirgends im Buch erwähnt, korrespondiert diese Denkweise vom Bild und dessen Einflussnahme auf die Abläufe der Produktion, Zirkulation und Rezeption von Kunst mit dem, was auch durch die Konditionen des „Post-Internet“ ausgedrückt wird. Die Künstlerin Marisa Olson umschrieb mit dem Begriff „Post-Internet Art“ erstmals jene Kunstwerke, die nach Aufkommen des Internets und der computergestützten und -modifizierten Bildproduktion entstanden, im Gegensatz zu solchen, die für das Internet geschaffen und über dieses verbreitet werden. Die Auffassung, dass die Bedingungen im Post-Internet sämtliche Typologien und Varianten des Kunstschaffens beeinflussen, fand durch die weit verbreitete Publikation des Essays The Image Object Post-Internet (2010, natürlich als PDF…) des Künstlers Artie Vierkant große Beachtung und sorgte für kontroversen Diskussionsstoff. Wie Joselit interessiert sich auch Vierkant für die Wirkmacht der Zirkulation und spricht hier mitunter dem Bild eine größere Rolle als dem Objekt zu; vor allem widmet er sich der Frage, wie (etwa durch computergenerierte Bildobjekte und 3D-Druck) Kunstwerke vom virtuellen Raum zum White Cube der Galerie und wieder zurück wandern können, mit anderen Worten, dieselbe Arbeit quer durch verschiedene Formate existiert, was auch durch die Wortverbindung „Bildobjekt“ im Titel betont wird. Vierkant nutzt jedoch seinen Post-Internet-Diskurs nicht als Basis einer Kritik, sondern umschifft darin gekonnt Fragestellungen zu den Währungen und Ökonomien in den Transfers zwischen dem digitalen Raum des Betrachtens und Produzierens und der Präsentation derselben Arbeiten in kommerziellen Galerien bzw. welche Formatierung die Galerie dabei vornimmt. Der Essay ist bewusst im programmatischen Stil eines typischen Künstler*innen-Statements mit historisch-konzeptueller Rahmung geschrieben, einem Kanon entsprechend, in den Vierkant auch die Post-Internet-Kunst einfügt – mitsamt deren Protagonist*innen wie Seth Price und Jon Rafman, die er unter dieser Rubrik als Träger eines Kulturerbes, das mit dematerialisierte Kunstpraktiken zu umschreiben wäre, anführt. Sie ist demnach letztlich in jene Machtkreisläufe eingebunden, die Joselit als den Bestimmungsort der Bilder und Bildproduktion nach der Kunst (und, mit Vierkant gesprochen, nach Kunst nach dem Internet) identifizierte.7
Dennoch eröffnet uns die Konnektivität die Möglichkeit, Bild und Objekt nicht als getrennte, sondern als gestaltverändernde und überlappende Einheiten zu betrachten, von denen keine vor- oder nachrangig ist, sondern die schlicht Formatierungsweisen des Inhalts sind und dadurch Währungscharakter erhalten. Im Gegensatz zum Medium setzt das Format einen Input und einen Output voraus – also eine Transformation sowohl im Sinne einer Währung als auch einer Spekulation wie im Finanzwesen, die Mehrwert generiert.
Das zirkulierende Bildobjekt
Die Veränderungen in der diskursiven Formation der zeitgenössischen Kunst – als postmediale Formen wie auch hinsichtlich ihrer Formate – haben also mit Machtbeziehungen zu tun und, wie in Michel Foucaults obenstehender Beschreibung, mit dem Verhältnis zwischen Macht und Wissen, das im Umgang mit Objekten (und deren Untergang) wie auch bei der Produktion von Subjekten (und auch hier: deren Untergang) zum Tragen kommt. Foucaults Überlegungen zum Diskurs sind natürlich nicht rein abstrakt und betreffen nicht nur Wissenssysteme (wie die akademischen Disziplinen), sondern ebenso institutionelle Räume und Praktiken bis hin zur Einschreibung auf und in reale Körper: als Medizin, die im Krankenhaus praktiziert wird, Strafe im Gefängnis, Psychiatrie in der Anstalt und so weiter. Aufbauend auf Foucaults Diskursanalyse über die Geburt des Museums prägte Tony Bennett den Begriff des „Ausstellungskomplexes“, der die Institution selbst umfasst sowie deren Aktivitäten des Sammelns und Zeigens, welche er als Anschauungsunterricht der Macht beschreibt – „die Macht, über Dinge und Körper zu verfügen und sie öffentlich zur Schau zu stellen“.8 Diese Lektionen finden aus bestimmten Gründen in der Öffentlichkeit statt: Einerseits, um der Bevölkerung die Mächtigkeit des Souveräns oder des Staates zu demonstrieren, andererseits aber auch, um sie zur Teilhabe am Narrativ der Ausstellung und Sammlung zu ermächtigen und sie so faktisch gleichzeitig zum Subjekt und Objekt des Wissens (und damit der Macht) zu machen. Historisch gesehen bestand das Ausstellungsdisplay in den Anfängen des modernen Museums im 19. Jahrhundert tatsächlich aus Gegenständen und Artefakten sowie aus Bildern in Form von Gemälden. Im zeitgenössischen Umfeld – und dem des Post-Internet – sollten wir jedoch eher von Bildobjekten sprechen, die innerhalb und jenseits des Galerieraums zirkulieren. Wobei kein Museum, das diesen Namen verdient, heute darauf verzichten würde, seinerseits durch Bildobjekte Lektionen der Macht auf ihren virtuellen Plattformen und sozialen Medienkanälen zu erteilen.
Dass Museen und Galerien durch ihre Ausstellungs- und Veranstaltungsvarianten unterschiedliche Formate anwenden und dabei zwischen Öffentlichkeit und Nicht-Öffentlichkeit sowie höheren und niedrigeren Niveaus oszillieren, ist wohl eine wenig originelle Erkenntnis, und ebenso wenig neu ist auch, dass sie in komplexen Macht- und Wissenskreisläufen verwoben und Teil einer Netzwerkkultur sind. Aber die Bedingungen des Post-Internet, unter denen sich die Gewichtung von der Produktion auf die Zirkulation verlagert, rufen noch deutlicher in Erinnerung, dass sämtliche unserer Institutionen, Museen, Galerien und freien Off-Spaces in Währungskreisläufen vernetzt sind und handeln. Die fast schon unentbehrlichen digitalen Plattformen sagen zwar nichts über das tatsächliche Netzwerk eines bestimmten Museums aus, doch offenbaren sie, dass sie nicht in sich geschlossen agieren, sondern als Transformatoren oder verknüpfte Netze mit einer Vielzahl an Inputs und Outputs dienen. Zwischen diesen Inputs und Outputs steht, natürlich, eine Maschine, oder das, was Foucault als „Dispositiv“ bezeichnet hat: der Apparat.
Das Dispositiv
In den zentralen Wissens- und Machtkategorien wurde der Begriff des Apparats bzw. Dispositivs in Foucaults Arbeiten niemals wirklich klar definiert, sondern beharrlich mit Klammern versehen und relativiert; obwohl, wie Giorgio Agamben in seiner Schrift in Analyse des Foucaultschen Terminus anmerkt, durchaus eine gangbare Definition vorgelegt wurde, gewissermaßen zumindest, und zwar in einem Interview aus dem Jahr 1977, die für unsere Zwecke nützlich ist. Sie offenbart sich hier anhand einer Reihe von miteinander verwobenen Institutionen und Diskursen, Regelwerken und Bräuchen, Prinzipien und Praktiken und beinhaltet dabei ebenso klare Aussagen wie das, was daraus geschlossen werden kann: „Das Dispositiv selbst ist das Netz, das man zwischen diesen Elementen herstellen kann“ [Hervorhebung durch den Autor], und dass es sich interessanterweise „dabei um eine bestimmte Manipulation von Kräfteverhältnissen handelt, um einen rationalen und abgestimmten Eingriff in diese Kräfteverhältnisse, um sie in irgendeine Richtung zu entwickeln, um sie zu blockieren oder um sie zu stabilisieren, sie zu verwenden.“ 9 Hiermit wird genau das beschrieben, was Museen und Galerien durch ihre Formatierungen ausüben: Einmal repräsentieren sie ausgesuchte Geschichten und Historiografien, dann wieder sehen sie bewusst davon ab, um bestimmten Ideen und Identitäten Vorschub zu leisten, um genau dieselben wiederum zu anderer Zeit und an anderen Orten daran zu hindern, sich fortzuschreiben. Darüber hinaus ist die Kunstinstitution in sichtbaren wie unsichtbaren Netzwerken angesiedelt, in Regierungen und Gouvernementalität, in Öffentlichkeiten wie Gegenöffentlichkeiten, in Gemeinden und Wähler*innenschaften, Schirmherr*innen und Geldgeber*innen, in Vergangenheiten und Gegenwarten – und manchmal sogar in der Zukunft. Im seinem Wesen als Dispositiv, das ausgewählte Wissenssysteme unterstützt bzw. im Gegenzug deren Unterstützung genießt und in bestimmte Machtbeziehungen eingebettet ist, besteht somit kein struktureller Unterschied zwischen dem staatlichen oder privaten Museum einerseits und der unabhängigen oder von Künstler*innen geführten Galerie andererseits. Sie unterscheiden sich vielmehr durch ihre jeweiligen Netzwerkaktivitäten und ihrem Anschluss an oder eben Ausschluss von ganz bestimmten Netzwerken sowie durch ihre Skalierbarkeit, wie Joselit dies in seiner Ausführung zum Format ausdrücken würde; nicht nur von oben nach unten, sondern auch von rechts nach links, vorwärts und rückwärts. Wir könnten auch Benjamin Brattons etwas rezentere und weitaus gründlichere Analyse des Regiments von architektonischen und computergestützten Apparaten heranziehen, in der auch vom stacking [Stapeln] institutioneller Formen die Rede ist, einer Ordnung also, die nicht nur modular vernetzt, sondern auch in Schichten und vertikal aufgebaut ist.10
Wie sich vielleicht aus dieser Darlegung ablesen lässt, ist das Dispositiv eine gleichzeitig konkrete und abstrakte Maschinerie, die ausgehend von den historischen Fallstudien Foucaults in den 1970er-Jahren ebenso auf den Ausstellungskomplex und die Kulturinstitutionen anwendbar ist; noch zusätzlich auf die modernen Gesellschaften – insbesondere auf die Verhältnisse im Post-Internet – ausgeweitet, kann das Dispositiv nun schon beinahe als Leitprinzip von Kontroll- und Machtmechanismen analysiert und produktiv gemacht werden. Tatsächlich nimmt Agambens Neubetrachtung des Begriffs eine solche Ausweitung und auch Zuspitzung von Foucaults ursprünglicher Konzeption vor. Eingangs behauptet Agamben, das Dispositiv sei „alles, was irgendwie dazu imstande ist, die Gesten, das Betragen, die Meinungen und die Reden der Lebewesen zu ergreifen, zu lenken, zu bestimmen, zu hemmen, zu formen, zu kontrollieren und zu sichern“.11s/sup>
In diesem erweiterten Sinne bestehen Dispositive also aus konkreten Architekturen der Macht, aus Gebäuden, Grenzen und so weiter, aber auch aus dem Gebrauch von Sprache, von juristisch bis poetisch, und schließlich aus Maschinen, die wir ansonsten als technische Hilfsmittel erachten, wie Computer oder Mobiltelefone. Wenn man an Agambens Vorliebe für klassische und theologische Texte denkt, ist es bemerkenswert, wie sehr seine Sprache des Erfassens, Abfangens und Modellierens an die Welt des Computers und Digitalen erinnert oder auch an das infrastrukturelle Denken von Autor*innen wie Bratton und selbst Joselit. Neben einer solchen Aktualisierung und Modernisierung des Dispositivs als analytisches Werkzeug nimmt Agamben eine noch radikalere Wendung, indem er unsere Gegenwart – die zeitgenössische Verfasstheit im Post-Internet – in zwei beinahe diametral entgegengesetzte Substanzen aufteilt: auf der einen Seite die Lebewesen, verstrickt in einem fatalen Kampf mit der anderen Seite, den Dispositiven der Gouvernementalität! Zwischen diesen Kräften, und als Ergebnis ihres Kampfes, ersteht das Subjekt – und zwar kein emanzipiertes und aufgeklärtes, sondern ein angeschlagenes und verletztes. Das bedeutet es also, niemals modern gewesen zu sein, sondern im wahrsten Sinne postmodern. Eine solche Schlussfolgerung zeichnet freilich ein ziemlich düsteres Bild von den Institutionen der Kunst – nach Kunst, besser gesagt – und spricht zum einen für politischem Widerstand, aber auch insgesamt für einen ethischen Wandel hinsichtlich dem, wie wir sowohl Dispositive als auch Formate instituieren und (um)nutzen sollten.
Formate beim Kunstraum Lakeside und ihr Nachleben
Es ist also nur opportun, dass das Ausstellungsprogramm des Kunstraum Lakeside im Jahr 2020 dem Begriff des Formats gewidmet war und uns damit auch erlaubt, die Institution selbst als Dispositiv und diskursive Formation in Betracht zu ziehen – wohl nicht ganz zufällig trägt ein Teil des Ausstellungskonzepts den Namen „Statements“, ein Schlüsselbegriff in Foucaults Auslegung von diskursiven Formationen. Die vielfältigen künstlerischen Projekte waren thematisch, aber auch methodologisch verbunden und setzten Formate, die Verschiebung zwischen Formaten sowie die Umwandlung von Währungen auf buchstäbliche Weise ein. Alle Projekte bezogen sich auf den Ort selbst, seine Architektur und 15-jährige Geschichte, wobei die Ausstellung und der Galerieraum selbst sowohl als Format als auch Knotenpunkt in einem intern wie extern existierenden Netzwerk eingebunden wurden. Besonders klar ersichtlich war dies bei Josef Dabernig, der sein eigenes, vor 15 Jahren geschaffenen Design des Kunstraums einer Neubetrachtung unterzog. Auch Ernst Miesgang unternahm eine Formatierung der Gegenstände und Strukturen, die er innerhalb der Institution sowie in deren unmittelbaren Umgebung, dem Lakeside Wissenschafts- und Technologiepark, vorfand, indem er mithilfe modifizierter Gerätschaften von ihnen Scans und Tonaufnahmen anfertigte – er also den Gebrauchswert von spezifischen Formatierungswerkzeugen unterwanderte (sozusagen durch Zweckentfremdung eines Dokumente-Scanners und eines Stethoskops). Der durch Formatierung veränderliche Status des Bildobjekts spielte auch bei Michaela Schwentners und Lone Haugaard Madsens Projekten insofern eine Rolle, als die ausgestellten Gegenstände neu registriert und arrangiert wurden: bei Schwentner durch die Rekonfiguration bestehender Elemente sowie mit choreografischen und filmischen Mitteln; und in Madsens Arbeit dadurch, dass wieder ein anderer Künstler ihre Malereien und Skulpturen abfotografierte, was eine Verschiebung des Formats der Arbeit mitsamt unseres eigenen Betrachtungsstandpunkts und der Idee von Autor*innenschaft zur Folge hatte – ja, die Positionen von Betrachter*innen wie Urheber*innen in der Ausstellung durcheinander gebracht wurden. Die Frage der Grenzziehung zwischen dem Werk einer Person und jenem einer anderen stand auch im Zentrum von Maria Anwanders und Ruben Aubrechts Interventionen, bei denen die Künstler*innen jeweils eine Arbeit auf Basis einer früheren des bzw. der Partner*in schufen (das Duo teilt sich auch ein Studio, was die Übergänge zwischen den künstlerischen Praktiken weiter verwischt). Dieses Verweben von individuellen Arbeitsweisen kann, im Licht der (Re-)formatierung, gleichzeitig als Auflösung und Ausweitung der jeweiligen persönlichen Methodik und Identität gelesen werden: Kunstwerke, die buchstäblich nach Kunst produziert wurden. Eine Gemeinsamkeit der Projekte war zudem auch das übergeordnete Denkmodell von der Ausstellung als Format – im Gegensatz zum altbekannten kuratorischen Prinzip der Ausstellung als Medium – in welchem die Zirkulationsweisen von Bedeutungen und Werten anstelle des Status des Bildobjekts selbst im Vordergrund stehen, der Fokus also eher auf seinem Bestimmungsort als seinem Ursprung liegt. Das Bildobjekt wird nicht verweigert oder dekonstruiert, sondern formatiert, was wiederum Fragen zu dessen Provenienz und Authentizität aufwirft und uns zur Teilhabe, bewusst oder unfreiwillig, in Netzwerken und Währungskreisläufen hinführt – mit anderen Worten, in ein Spiel mit der Produktion von Wahrheit.
Maria Anwanders treffend mit & Ruben Aubrecht sowie Ruben Aubrechts dito mit & Maria Anwander übertitelte Pseudo-Einzelausstellungen konnten nicht wie geplant stattfinden. Die Eröffnung der beiden Schauen bzw. der Doppelausstellung am 10. November 2020 musste aufgrund der Covid-19- Pandemie abgesagt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt gab es jedoch eine kurze Periode, in der man sie vor Ort sehen konnte. Und trotz alledem zirkulieren die Arbeiten noch stets in den Diskursen der zeitgenössischen Kunst, nicht zuletzt natürlich durch eben diese Publikation und den vorliegenden Aufsatz.
Womit wir wieder bei der Formatierung als andere Form des Transfers und der Zirkulation von Ideen angelangt wären. Dies ist insofern bemerkenswert, als die Pandemie unseren Planeten nun seit über einem Jahr heimsucht, mit allen Konsequenzen, die die Maßnahmen zum Social Distancing für Kunstinstitutionen mit sich gebracht haben und damit für die Art und Weise, wie wir Kunstwerke erleben können, den Auftrag dieser Einrichtungen, der Öffentlichkeit Begegnungen mit Kunst zu ermöglichen, und zwar an Orten, wo sich die Menschen einfach treffen können. So wie es aussieht, können wir uns nicht mehr wie gewohnt versammeln, etwas ansehen, bewerten und diskutieren – genug Anlass, das Format ändern zu müssen, wenn nicht auch die Währungen der Kunst und Kultur. Mit dem Abhalten von Ausstellungen und den meisten diskursiven öffentlichen Veranstaltungen über das Internet werden Kunstwerke und Sprecher*innen, die nur aus Kopf und Schultern bestehen, zu bloßen Pixelgebilden reduziert, ironischerweise gerade auf Betreiben von traditionell stark am Objekt ausgerichteten kommerziellen Galerien und staatlichen Museen, aber auch, wenn auch in geringerem Maße, von freien Kunsträumen wie dem Kunstraum Lakeside. Wie können geschlossene Räume neu formatiert werden? Wie sollen wir Institutionen befragen, die wir nicht besuchen können? Und die vielleicht wichtigste Frage: Wie und wo können wir uns tatsächlich versammeln? An dieser Stelle kann es sicherlich hilfreich sein, über Formate und Netzwerke, Mechanismen der Konnektivität und Dominanz nachzudenken. Eine Veränderung des Formats kann vielleicht, analog den Formatkriegen der Musikindustrie, das Hörerlebnis auf sozialer und ästhetischer Ebene beeinflussen, aber es macht das Dispositiv als Netzwerk nicht ungeschehen, in positiver wie negativer Hinsicht. Vielmehr sollte diese Option uns daran erinnern, wie Formate auch dazu genutzt werden können und sollen, eine Änderung der Währung herbeizuführen – was auch Foucaults Idee von Kritik entspricht, die er anhand der griechischen Kyniker und deren Ausübung der parrhésia formulierte, nämlich ein Wahrsprechen gegenüber der Macht.12 Foucault zufolge sahen die Kyniker die vielfach romantisierte parrhésia nicht als politische Strategie in einem pragmatischen oder technischen Sinne, sondern als ethischen Wandel: eine Form der Diskussion, bei der nicht auf eine bestimmte Problemstellung eingegangen, sondern diese umgedreht wird, wodurch sich die Parameter der Debatte selbst verschieben und damit auch die Währung ändert. Demnach sollte unser Für- und Dagegensprechen der Frage gewidmet sein, wie dem Bildobjekt der Kunst oder, wenn man so will, des Kapitals begegnet werden soll, und weniger den historischen Verschiebungen vom Medium zum Postmedium und von der Form zum Format. Die Kunst hat – um zum einleitenden Bezug auf die Musikkultur zurückzukommen – wenn nicht den Raum, aber sicherlich das Medium längst hinter sich gelassen.
Veröffentlicht in
Franz Thalmair (Hg.): Kunstraum Lakeside — Format,
Verlag für moderne Kunst: Wien, 2021.
Download
1 Agamben, Giorgio: Was ist ein Dispositiv?, übers. v. Andreas Hiepko, Zürich: diaphanes, 2008, 23–24.
2 Joselit, David: Nach Kunst, Berlin: August Verlag, 2016, 73.
3 Vgl. Danto, Arthur C.: Das Fortleben der Kunst, übers. v. Christiane Spelsberg, München: Wilhelm Fink Verlag, 2000; Decter, Joshua: Art Is a Problem: Selected Criticism, Essays, Interviews and Curatorial Projects (1986–2012), Zürich: JRP|Ringier, 2013; Lee, Pamela M., Forgetting the Art World, Cambridge, MA: MIT Press, 2012.
4 Joselit, 107, fn 9.
5 Foucault, Michel: Über den Willen zum Wissen, Vorlesungen am Collège de France 1970/71, Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 2012, 283.
6 Joselit, 73.
7 In Bezug auf das Format in seiner Funktion als Feststellung und Zirkulation von Werten, kann es interessant sein, sich die Doppelbedeutung des Wortes Portfolio, wie Joselit angeregt hat, ins Gedächtnis zu rufen; und zwar einerseits als Verzeichnis der Arbeiten von Künstler*innen, das Kurator*innen, Galerist*innen, Sammler*innen und anderen Vermittler*innen vorgelegt wird, und andererseits im Sinne eines Index von Investitionskategorien (wie Aktien, Anteile und Immobilien).
8 Bennett, Tony: „Der Ausstellungskomplex“, in Der documenta 14 Reader, hg. v. Quinn Latimer und Adam Szymczyk, übers. v. Herwig Engelmann et al., München: Prestel Verlag, 2017, 359.
9 Zitiert von Agamben, 8.
10 Bratton, Benjamin H.: The Stack – On Software and Sovereignty, Cambridge, MA: The MIT Press, 2016.
11 Agamben, 26.
12 Foucault, Michel: Die Regierung des Selbst und der anderen II. Der Mut zur Wahrheit, Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2010.