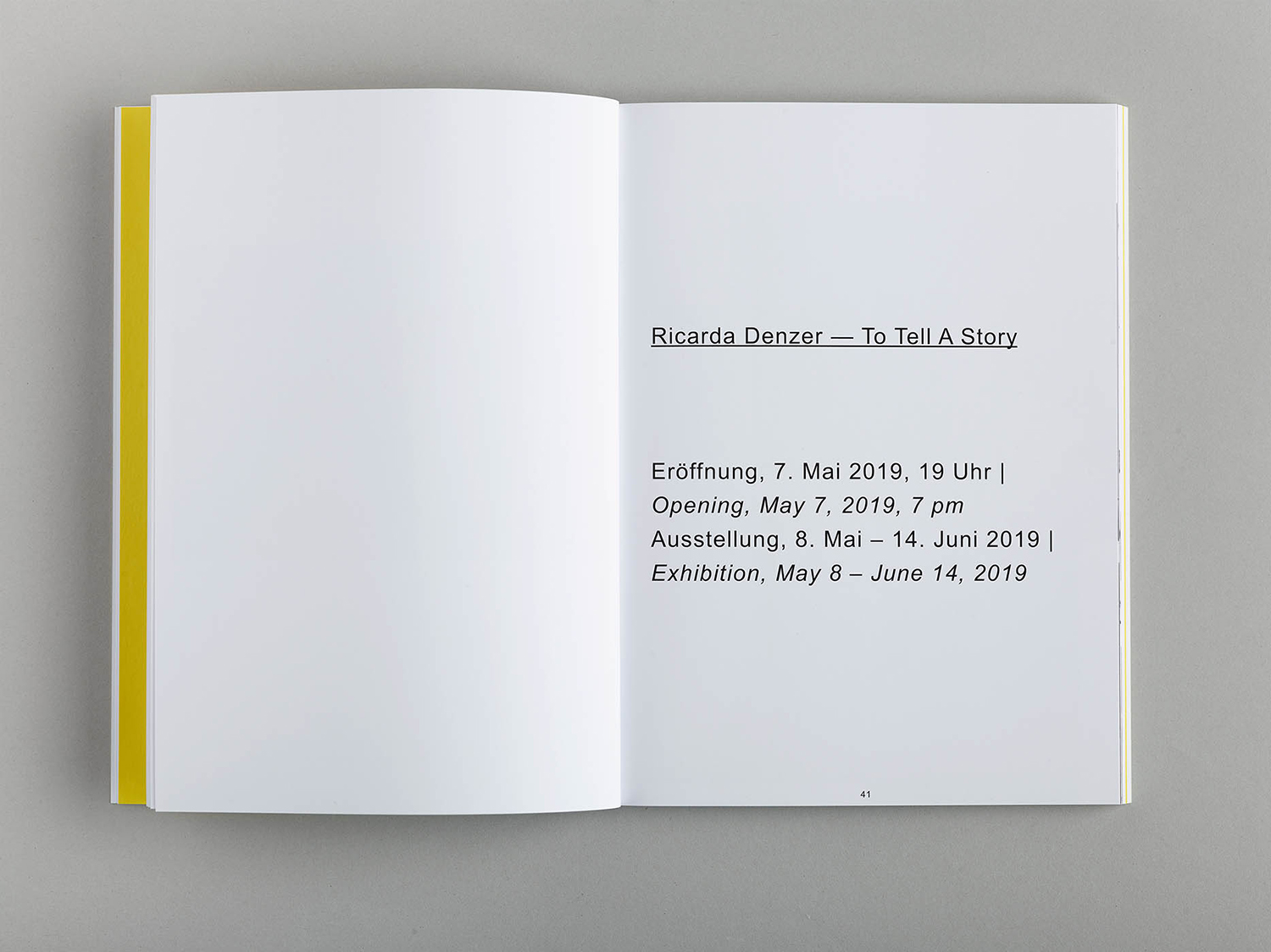Anette Baldauf
Die Aufregung begann einen Tag vor der Eröffnung: In seiner Vorbesprechung der Biennale im Whitney Museum vom 16. März 2017 postete der Kunstkritiker Jerry Saltz ein Foto von Dana Schutz’ Gemälde Open Casket und nannte es schön. Viele der anschließenden Kommentare stellten die Bezeichnung „schön“ infrage, da sich die Malerei auf den Leichnam eines schwarzen Jungen, der von weißen Suprematisten gewaltsam verunstaltet worden war, bezog. In derselben Nacht stellte der Künstler Devin Kenny auf Facebook eine Reihe von Fragen zu Schutz’ Werk: „Wer ist das Publikum für dieses Bild? […] Welche Handlung soll dieses Werk vorgeblich oder tatsächlich setzen? Informieren? Schockieren? Eine Verbindung aufbauen? Hilft es einem neuen Publikum, sei es emotional oder intellektuell, all die komplexen Faktoren zu begreifen, die unter Begriffe wie Weißer Suprematismus, Sexismus und Anti-Blackness fallen und zum Tod dieses jungen Menschen geführt haben?“1
Am nächsten Tag eröffnete die Whitney Biennale schließlich mit Open Casket an einer Wand in den Ausstellungsräumen. Auf der Leinwand deuteten mit dicken Pinselstrichen aufgetragene braune, rote und gelbe Linien die Konturen eines Kopfes an, umrahmt von einem hellgelben Farbkranz. Dem Farbknäuel im oberen Bildrand war unterhalb ein feiner gemaltes, eher figuratives Arrangement beigestellt, das ein weißes Hemd mit Knöpfen sowie eine schwarze Jacke andeutete. Trotz seiner abstrakten Komposition ließ der Titel des Bildes wenig Zweifel über dessen historische Referenz offen: das Begräbnis des 14-jährigen Emmett Till im offenen Sarg im Jahr 1955.
Einen Tag nach der Biennale-Eröffnung initiierten schwarze Künstler*innen und Aktivist*innen eine Mahnwache; sie positionierten sich vor Open Casket im Versuch, das Sichtfeld der Besucher*innen zu verstellen und das Bild vor aufdringlichen Blicken zu schützen. Der Künstler Parker Bright postete Videos, die zeigten, wie er vor dem Gemälde den Mantel auszog und sein T-Shirt mit der Aufschrift „Black Death Spectacle“ zum Vorschein kam. Andere Künstler*innen schlossen sich Bright an; ruhig stellten sie sich neben ihn oder lösten ihn an seinem Platz vor dem Bild ab. Dann schließlich stellte die Künstlerin und Autorin Hannah Black einen offenen Brief auf Tumblr:
An die Kurator*innen und Mitarbeiter*innen der Whitney Biennale: Mit diesem Schreiben ersuche ich euch, Dana Schutz’ Werk Open Casket zu entfernen – mit dem dringenden Rat, das Bild zu zerstören und nicht in irgendeinen Marktkreislauf oder ein Museum gelangen zu lassen. Wie ihr wisst, zeigt das Bild die Leiche des 14-jährigen Emmett Till im offenen Sarg, wofür sich seine Mutter mit den Worten entschieden hatte: „Lasst die Leute sehen, was ich gesehen habe.“ Dass nicht einmal der entstellte Leichnam eines Kindes ausreichte, um den weißen Blick von seinem gewohnt kalten Kalkül abzubringen, wird uns täglich und auf alle erdenkliche Arten vor Augen geführt, nicht zuletzt durch die Tatsache, dass das Bild überhaupt existiert. Kurz gesagt: Das Bild sollte für jeden und jede inakzeptabel sein, der oder die sich über das Schicksal schwarzer Menschen Gedanken macht, oder dies vorgibt, weil es nicht akzeptabel ist, dass eine Weiße schwarzes Leid in Profit und Spaß umwandelt, auch wenn diese Praxis schon lange normal erscheint.2
Weiße Ignoranz und die Politik des weißen Blicks
Black fasste zusammen, worauf Künstler*innen schon vor der Veröffentlichung des Briefes hingewiesen hatten: Emmett Till wurde 1955 in Mississippi von zwei weißen Männern gelyncht. Der Sheriff von Mississippi händigte Tills misshandelten Körper seiner Mutter nur unter der Bedingung aus, dass der Sarg beim Begräbnis geschlossen bleiben müsse. Mamie Till-Mobley verweigerte dies und bat zudem um weite Verbreitung des Fotos ihres Sohnes im offenen Sarg. Sie wollte „die Welt sehen lassen, was ich gesehen habe […] Die ganze Nation sollte Zeugin sein.“3 Mehr als 600.000 Menschen kamen zur Aufbahrungshalle, um Zeugnis von dem brutalen Mord abzulegen; und die Wochenzeitschrift Jet sowie die Lokalzeitung Chicago Defender veröffentlichten das Bild von Emmetts verunstaltetem Gesicht.
In ihrem Essay The Condition of Black Life is One of Mourning beschrieb Claudia Rankine, wie Mamie Till-Mobleys Intervention Trauer zu einer öffentlichen Handlung machte: „Mobleys Weigerung, privates Trauern privat zu halten, erhob einen Körper, der dem Strafjustizsystem nichts bedeutete, zum Beweismittel.“4 Diesem Gedanken folgend, interpretierten Josephine Livingstone und Lovia Gyarkye Mamie Till-Mobleys Entscheidung als eine Umkehrung des visuellen Regimes, das den Terror des Lynchens erst konstituiert: „Obwohl er ihr genommen wurde, in der Art wie gelynchte Amerikaner*innen ihren Familien genommen wurden, schaffte sie es, die letzte Stufe des öffentlichen Mordes, nämlich das Spektakel, herumzudrehen.“5 Sie argumentieren, dass Mobleys Einladung eine Verschiebung des Spektakels hin zur Zeug*innenschaft initiiert hatte: Die kollektive Schau auf den Lynchmord wies weiße Südstaaten-Amerikaner*innen als eine Gemeinschaft unter dem Banner des weißen Suprematismus aus – nun, da das Bild des gelynchten Körpers zur Versammlung einer schwarzen Trauergemeinde animiert hatte. Indem Mobleys Vorstoß der Gemeinschaft des Publikums neue Geltung verlieh, unterminierte er den dominanten Blick des Voyeurismus und verwandelte die Politik des morbiden Zuschauens in die einer Verweigerung und Empörung.
Es wird vielfach behauptet, dass die Tötung von Emmett Till einen Wendepunkt in der Geschichte der Bürger*innenrechtsbewegung markierte; und dass die zum Beweismittel für den Terror an schwarzen Existenzen erhobenen Fotografien dieser zu starkem Aufwind verhalfen. Als Beweis für eine USA, die sich weigerten, die Rassentrennung aufzuheben, verfolgte die Fotografie des Emmett Till Generationen von Afro-Amerikaner*innen; unzählige ihm gewidmete Lieder, Gedichte, Kunstwerke und Romane zeugen von der zentralen Bedeutung seines Lebens wie auch seines Sterbens.6 Aus diesem Grund stehen die Fotografie und das daran geknüpfte Narrativ als Beweismittel in einem schmerzhaft zwiespältigen Zusammenhang. In ihrem Essay Can You Be BLACK and Look At This’: Reading the Rodney King Video(s) schreibt Elizabeth Alexander: „Die Erzählung des Emmett Till zeigt auf, wie schwarze Menschen – um überleben zu können – paradoxerweise sowohl deren eigene Ermordung und Schändung mitansehen als auch das epische Ausmaß der geschehenen Entrechtung weiterkommunizieren mussten.“7
Nach der Eröffnung der Whitney Biennale wurde die Mahnwache zum Schutz des Gemäldes vor den konsumierenden Voyeur*innen im Museum fortgesetzt. Diese „wake work“ ist Christina Sharpe zufolge als affektive Arbeit zu bezeichnen; sie schafft Rituale, um die Toten zu betrauern sowie an sie und die Beziehungen zu ihnen zu erinnern. Sharpe listet die verschiedenen Bedeutungen des englischen Begriffs „wake“ – das Kielwasser eines Schiffs, die Totenwache, das Wiedererlangen von Bewusstsein – und zeichnet die Spuren der Gewalt und des Schmerzes wie auch die Überlebensstrategien im Angesicht schwarzer Negation nach. Im Kontext professionalisierter Obsorge durch Gefängnisse, schenkt wake work Aufmerksamkeit, versucht Beistand zu leisten und Wege zu finden, aufeinander zu achten.8 „Wake work ist die Arbeit, die wir Schwarzen angesichts unseres andauernden Sterbens leisten, und steht für unser Insistieren auf das Leben in der Gegenwart“, schreibt sie. Und in Bezug auf die Mahnwache vor Open Casket fügt sie hinzu: „Ich finde es wirklich sehr kraftvoll, wie diese jungen schwarzen Menschen ihren Körper vor das Bild stellen. Das ist für mich tatsächlich eine Mahnwache. Diese jungen schwarzen Menschen halten Wache bei den Toten und praktizieren damit eine Form von Fürsorge.“9
Abseits des Museums zog Hannah Blacks Brief die Diskussion in die Mainstream-Medien, wo sie vor allem um Fragen zu kultureller Aneignung und Zensur zirkulierte. Kritiker*innen beschuldigten Schutz, in dieselben Mechanismen zu verfallen, die Greg Tate mit „Everything but the Burden“ umschrieb, mit anderen Worten, sich schwarzer Musik-, Tanz-, Bekleidungs- und Sprachstile zu bedienen, und nun auch der Zeichen des Leidens, ohne mit der permanenten Terrorisierung konfrontiert zu sein, die den schwarzen Alltag in den USA seit Beginn der Sklaverei bestimmt hat.10 Schutz’ Verteidiger*innen argumentierten hingegen, dass keiner Gruppe von Menschen ein bestimmtes Subjekt oder eine bestimmte Geschichte gehöre und dass die Forderung das Bild abzuhängen oder gar zu zerstören dem Geist des Nationalsozialismus entspräche. Als sich die Debatte ausweitete, reagierte Dana Schutz in einem Interview mit der New York Times auf Hannah Blacks Brief.
Ich weiß nicht, wie es ist, als Schwarze in Amerika zu leben, aber ich weiß, wie es ist, Mutter zu sein. Emmett war Mamie Tills einziger Sohn. Der Gedanke, dass deinem Kind etwas zustoßen könnte, entzieht sich jeder Vorstellungskraft. Ihr Schmerz ist dein Schmerz. Mein Zugang zu diesem Bild entspringt dem Mitgefühl mit Emmetts Mutter. […] Kunst kann ein Raum für Empathie sein, ein Vehikel, um Verbindungen aufzunehmen. Ich glaube nicht, dass man jemals wirklich wissen kann, wie es ist, jemand anderes zu sein (ich werde nie die Ängste schwarzer Eltern kennen können), aber wir sind einander wiederum auch nicht vollständig fremd.11
Empathische Identifikation: „Ich fühle mit dir / für dich“
In der Kunst wie auch Sozialtheorie wird Empathie oft als wertvolle Quelle des Studiums erachtet. Im Umfeld der psychoanalytischen Theorie wurde sie als probates Mittel vorgeschlagen, unbewusst vom Subjekt der Forschung zum/zur Forschenden transferiertes Material zu erschließen und so ein produktives Wechselspiel zwischen Partizipation und Beobachtung herzustellen.12 Kritiker*innen wiesen aber auch darauf hin, dass im Kontext der Psychoanalyse eingebrachte Empathie diese auch gleichermaßen an ein Wissen um die menschliche Natur gekoppelt ist, eine Universalität der Gefühle und, in vielen Fällen, auch an die Überlegenheit des mitfühlenden Subjekts.
In der Sozialforschung suggeriert der Hinweis auf Empathie, dass Forscher*innen, ungeachtet ihrer unterschiedlichen Lebenswelten, mit den geeigneten Mitteln in der Lage wären herauszufinden, wie das untersuchte Subjekt fühlt und, ebenso wichtig, diese Gefühle in Worte zu fassen. Aber wenn Empathie von jeder Reflektion über Positionalität getrennt wird, etwa die Reflektion über wer hier spricht und unter welchen Umständen, wird – trotz des Versprechens, die Lücke zwischen dem/der Forschenden und dem Erforschten zu schließen – in vielen Fällen das gegebene Ungleichgewicht eher überdeckt als mit ihm oder dagegen gearbeitet. „Ich fühle dich (und mit dir)“, sagt wenig über das Verhältnis zwischen Forscher*in und Forschungssubjekt aus, das kulturelle Gefüge und Spiel der Kräfte, das die Forschungstreibenden mit denen, über die Forschung betrieben wird, verbindet. Die Aussage neigt deshalb eher dazu, die Dynamiken des Othering zu forcieren und damit zur Verfestigung der sogenannten pain narratives („Schmerzerzählungen“) in marginalisierten Gesellschaftsgruppen beizutragen. So formuliert bell hook in ihrer Kritik der konventionellen Ethnografie: „Deine Stimme brauche ich nicht zu hören. Erzähle mir nur dein Leid. Ich möchte deine Geschichte kennen. Und dann werde ich sie dir auf neue Weise zurückerzählen. […] Ich bin noch stets der Kolonisator, das sprechende Subjekt, und jetzt stehst du im Zentrum meiner Rede.“13 An dieser Stelle droht das „Ich fühle mit dir“ in ein „Ich fühle für dich“ zu kippen: Der emotionale Zustand der Forschenden rückt ins Zentrum des Forschungsprozesses; ihr Schmerz, den sie für andere empfinden.
In ihrem Buch Scenes of Subjection. Terror, Slavery and the Self-Making in Nineteenth Century America bestätigt Saidiya Hartman diese Beobachtung, indem sie in ihrer Analyse von Aussagen weißer Anhänger*innen der Sklavenbefreiung aufzeigt, dass deren Appell an das Mitgefühl in vielerlei Hinsicht das Leid anderer zu ihrem eigenen macht. „Die Mühelosigkeit der empathischen Identifikation“, schreibt sie, „ist in gleichem Maße (ihrer) guten Absichten und aufrichtigen Gegnerschaft der Sklaverei geschuldet wie der Austauschbarkeit des gefangenen Körpers“.14 Sie identifiziert einen Dualismus zwischen der Spektakelhaftigkeit des schwarzen Leidens und der Ausbreitung dieses Leidens durch das Spektakel und fragt: „Kann der oder die weiße Zeug*in des Leid-Spektakels die Materialität des schwarzen Empfindens nur durch das eigene Fühlen anerkennen?“15
Im Kontext von Dana Schutz’ Open Casket beantworten Kritiker*innen diese Frage mit „Ja“. Sich auf Empathie zu berufen sehen sie hier als einen Versuch der Entrassifizierung von Geschichte. Durch den Rückgriff auf Empathie, so ihre Argumentation, leisten weder Kunstwerk noch das darauf folgende Statement affektive Arbeit, wie sie zur Artikulation des vielschichtigen Verhältnisses zu und mit einem/r Anderen notwendig wäre. Solch eine Form der Anteilnahme kann kaum als Beitrag einer „Reparations-Arbeit“, wie Tina Campt es nennt, betrachtet werden – sie bringt kein Bekenntnis zur Relationalität und Nachbar*innenschaft zum Ausdruck, kein Bemühen, den eigenen Bezug auf und eine Sprache für die vielgestaltigen Aspekte der fortdauernden Geschichte der Enteignung zu finden.16 Mit anderen Worten, verweigerte die Künstlerin mit ihrem Verweis auf Empathie eine Reflektion, inwiefern die Tötung nicht nur mit ihrer Position als Mutter, sondern auch mit ihrem eigenen Weißsein zu tun hat. Oder, anders ausgedrückt, könnte damit auch ein weiterer Bezug zur Ermordung zutage treten, nämlich der zu Carolyn Bryant, der weißen Frau, die Emmett Till der Belästigung bezichtigte und die 60 Jahre später gestand, dass die Anschuldigungen völlig frei erfunden waren. In Hinblick auf diese Konstellation schreibt Jared Sexton: „Schutz […] möchte nicht wie Bryant mit einer staatlich sanktionierten, rassistisch motivierten Gewalt in Verbindung gebracht werden und wohl insbesondere nicht mit jener Gewaltausübung auf schwarze Menschen, durch die interethnische sexuelle Kontakte unter Kontrolle gehalten werden sollen.“ Und fügt hinzu: „Sie vergisst indes, dass ihre interethnische mütterliche Empathie für Till-Mobley nichts an der Tatsache ändert, dass sie eine weiße Frau ist, die einen – noch dazu bekanntlich auf Initiative einer weißen Frau hin – getöteten schwarzen Jungen abbildet. Ihre Empathie ist mit dieser Initiative verwoben.“17
Die Whitney Biennale war nicht die einzige Museumsstätte, wo in letzter Zeit lokale Aktivist*innen die Ausblendung des White Gaze, des weißen Blicks, und das Verhältnis zwischen Ethik und Ästhetik ins Visier nahmen. 2017 entfernte das Walker Art Center Sam Durants interaktive Arbeit Scaffold. Durant hatte eine riesige Skulptur in Gedenken an die Hinrichtung von 38 Dakota-Stammesangehörigen im Jahr 1862 100 Kilometer südlich von Minneapolis gebaut; aber im Zuge der Erinnerungsarbeit an die größte Massenexekution in der Geschichte der Vereinigten Staaten hatten der Künstler und die Kunstinstitution verabsäumt, das Gespräch mit den lokalen indigenen Communitys zu suchen. Als sich nach der Eröffnung Protest regte und bald zu eskalieren drohte, organisierten die Stammesältesten der Dakota einen Mediationsprozess und luden das Walker Art Center ein, zusammen eine Lösung zu finden. Letzteres fügte sich schließlich dem Standpunkt der Dakotas, dass es in ihren Händen lag, Wege zum Gedenken an die Ermordungen zu finden, ohne ihre Geschichte zu trivialisieren sowie erneut zum Opfer und Trauma zu machen. In einer gemeinsamen Zeremonie wurde die Skulptur, unter Zustimmung Durants, schließlich abgebaut und vergraben. Sobald er erfahren habe, dass das Walker Art Center auf dem Land der Dakota erbaut wurde, so Durant in einem Interview, realisierte er, „dass man kaum einen besseren Musterfall für weiße Ignoranz an einem Ort haben könne“.18
In einem ähnlichen Disput, wenn auch mit weniger Bereitschaft zu lernen und zuzuhören, fand sich das Contemporary Art Museum in St. Louis, Missouri, im Zusammenhang mit Kelley Walkers Ausstellung Direct Drive. In der Schau arbeitete Walker mit digitalen Bildern der Bürger*innenrechtsbewegung, von Polizeigewalt gegen Afro-Amerikaner*innen und Titelseiten der Zeitschrift KING, viele davon beschmiert mit Schokolade und Zahnpasta. Bei einer öffentlichen Diskussionsrunde präsentierte der Künstler die formalen Elemente seines Werks, mit Ausführungen zum entkörperlichenden Potenzial digitaler Bilder. Als Mitglieder der lokalen Bevölkerung Walker ersuchten, seine eigenen Beweggründe, Absichten und das angepeilte Publikum angesichts der aktuellen Erschießungen durch die Polizei in der Stadt zu erklären, weigerten sich der Künstler und der Kurator darauf einzugehen und schlossen die Debatte. Daraufhin riefen die örtlichen Künstler*innen zum Boykott der Ausstellung auf.
Forschungsethik
In den letzten Jahren holten vielfältige Interventionen schwarzer und indigener Forschender Disziplinen wie die Anthropologie und Soziologie unsanft aus ihrer weißen Komfortzone, indem sie darauf insistierten, die zugrundeliegende Forschungsethik zu reflektieren und das Verhältnis zum weißen Suprematismus, Kolonialität und Ignoranz offenzulegen. Die eingeleitete Irritation ist laut Eve Tuck und Monique Guishard nur in geringem Maß der breiten Einführung von ethischen Reglements geschuldet, mit denen begonnen wurde, die Rechte von individuellen menschlichen Subjekten und die Verantwortlichkeit von Wissenschaftler*innen der westlichen Akademia zu definieren. Als die Institutional Review Boards (IRBs), also die diversen unabhängigen Ethikkommissionen, auf den ungeheuerlichen Missbrauch der Forschung im Kontext etwa des Nationalsozialismus reagierten, so Tuck und Guishard, entwarfen die entsprechenden ethischen Richtlinien aber kein Protokoll, wie auch die Mechanismen des Siedlungskolonialismus, des wissenschaftlichen Rassismus und weißen Suprematismus durchbrochen werden können. Im Wesentlichen zielen sie darauf ab, die Institutionen vor Missbrauchsvorwürfen zu schützen.19
„Ethik ist eine Pädagogik der Praxis“, meint Norman Denzin, und reflektiert deshalb die sozialen, politischen und kulturellen Strukturen, in denen sie eingebettet ist.20 Diese Pädagogik gemäß der Vorschläge der IRBs zu standardisieren, läuft oftmals auf die Universalisierung westlicher Ideen hinaus. Eine Reihe von Richtlinien lenkt das Verhalten gegenüber den Beobachteten; sie soll die Verursachung von Leid im Rahmen der Feldforschung minimieren. Solch eine Perspektive hinterfragt nicht zuvorderst das Recht, diese Forschung überhaupt zu betreiben und lässt die vielen Formen von Gewalt, die Forscher*innen womöglich bereits aus der Distanz anrichten, im Zuge ihrer Beschreibung und Interpretation des sogenannten Forschungssubjekts, unberührt.
Schon in den 1980er-Jahren rüttelte die feministische Forschung vehement am westlichen Forschungsethos und dem wissenschaftlichen Anspruch auf Systematizität, Reproduzierbarkeit und Wertfreiheit, aber zahlreiche schwarze und indigene Forschende wandten ein, dass auch ihre Kritik vom Erbe des Imperialismus und dessen ethischen Dilemmas belastet war. Donna Haraway und Sandra Harding hoben die Situiertheit jeder Forschung hervor und wiesen ihr darin Partialität als Stärke, und nicht als Schwäche zu. Wissen ist nach Haraway situiert, da es an einen partikularen Körper gebunden ist, dessen Situiertheit und zugehörige Perspektive.21 Während feministische Wissenschaftler*innen die sogenannte Outsider-Methodologie mit ihrer Betonung von Objektivität und Neutralität infrage stellten, brachten andere, wie Linda Tuhiwai Smith, eine Reihe tiefer gehender Bedenken ins Spiel: Mit ihrer berühmten Aussage, dass „das Wort ‚Forschung’ selbst möglicherweise eines der dreckigsten Wörter im Wortschatz der indigenen Welt [ist]“, erinnerte Smith an die im besten Fall irrelevanten, im schlechtesten Fall destruktiven Effekte der Forschung an indigenen Gemeinschaften. Von einer Außen- zu einer Innenperspektive zu wechseln, führt sie aus, gleicht nicht notwendigerweise die im Namen der „Wissenschaft“ legitimierten Gräueltaten aus.22 Ihrer Ansicht nach müssen Reflexivität in Hinblick auf die Positioniertheit der Forschung und die potenziellen Auswirkungen der Forschung sowohl auf den/die Forschende_n wie auch die jeweilige Community als zentrale Anliegen jeder Forschung verstanden werden. Junanita Sundberg bestätigt dies und schlägt vor, sich von der angeblichen Unbefangenheit eines Insiders zu verabschieden und stattdessen auf Verflechtungen und Kompliz*innenschaft zu fokussieren. Sie plädiert dafür, Ethik nicht als Mittel zur Beseitigung von Dilemmas zu sehen, sondern vielmehr als diskursives Feld, in dem die Parameter einer verantwortungsbewussten Involviertheit verhandelt werden.23
Hausaufgaben machen
Forscher*innen, die Dekolonialisierung suchen, nennen diesen Auftrag – die Prüfung der historischen Umstände und die Artikulation der eigenen Teilhabe und Relationalität im Kontext herrschender Gewaltstrukturen – „Hausaufgaben machen“. In der Tradition von Gayatri Spivak definieren Autorinnen wie Rauna Kuokkanen und Juanita Sundberg diese Hausaufgaben als selbstreflexive Arbeit, die in Hinblick auf die eigenen ontologisch und epistemologisch bedingten Annahmen zu erbringen ist.24 Sie umfasst eine Analyse des imperialistischen Fundaments eurozentrischer Wissensproduktion, welche eine durch eurozentrisches Denken etablierte Gewaltherrschaft reflektiert, die etwa darauf abzielt, eine Unterscheidung von dem, das als menschlich und dem, was also noch-nicht-ganz-menschlich gilt, Kultur und Natur, zu reproduzieren. Sie umfasst beispielsweise auch eine Auseinandersetzung mit der unterschwelligen Allianz zwischen Imperium und Empirismus, dem Cartesianischen Subjekt und weißem Suprematismus, der Aufklärung und dem Individualismus; und sie zielt auch auf eine Auseinandersetzung mit Privilegien, Schweigen und einer erkenntnistheoretischen Ignoranz. Das Verlernen lernen bedeutet in erster Linie, das Privileg zu verlernen, behauptet Kuokkanen, insbesondere das Privileg einer allgemein gebilligten Ignoranz, die das Aufrechterhalten des Schweigens über anhaltende koloniale Gewalt erlaubt.25 Hausaufgaben machen bedeutet zudem auch eine ehrliche Konfrontation mit Fragen zu den eigenen Motivationen, Erwartungen und Wünschen im Forschungsprozess. „Der Sinn dieser Hausaufgaben ist“, fasst Juanita Sundberg zusammen, „uns selbst auf solche Weise zu situieren, dass wir in der Lage sind, ethische Entscheidungen zu dem, was zu erforschen ist, mit wem, mit welchen Praktiken und welchen Zielen, zu treffen. Solche Hausaufgaben steigern ein Verantwortungsbewusstsein für die epistemologischen und ontologischen Welten, denen wir in unserer akademischen Praxis Ausdruck verleihen.“26
Das Bild Open Casket und die darum entflammte Debatte legen nahe, dass Dana Schutz wenig daran interessiert war, sich mit dieser Art Hausaufgaben zu beschäftigen. Ihr Kunstwerk und die folgenden Aussagen haben kaum einen Beitrag geleistet, das Naheverhältnis der Weißen zum schwarzen Leid aufzuzeigen. Während das Ringen mit diesem Verhältnis eine Vielfalt von Perspektiven eröffnen mag, setzt es zwangsläufig auch eine Konfrontation mit den historischen Spuren einer Gesellschaft voraus, die einst zwischen jenen, die mit Menschlichkeit, Rechten und Freiheit assoziiert, und jenen, die schon immer an Austauschbarkeit und Akkumulation gebunden waren, unterschied.27
Im Hinblick auf die Frage, was die Diskussion um Open Casket nun zum Antirassismus beitrug oder nicht, besteht Angela Pelster-Wiebe darauf, dass es keiner großen Geste, sondern einer Reihe einzelner Unterbrechungen jener täglichen Routinen bedarf, die die weiße Ignoranz fortschreiben. Laut Pelster-Wiebe besteht die Hausaufgabe weißer Künstler*innen darin, „zu lernen, zu warten bis sie an der Reihe sind, zu verstehen versuchen, was der Hintergrund der anderen Person ist, sich zu entschuldigen, wenn sie etwas falsch verstanden haben, zu wissen, wann es besser ist, den Mund zu halten und nur zuzuhören und zu bemerken, dass jemand anderes gerade unter seiner/ihrer Last erdrückt wird und einen anderen Körper braucht, der sich anbietet, dieses vernichtende Gewicht auf sich zu nehmen.“28
Weiße Ignoranz zu verlernen war sichtlich kein Anliegen, das die Künstlerin ver- und bearbeiten wollte. Im Gegenteil: Die Debatte veranlasste den Kunsthistoriker George Baker, das umstrittene Bild in Schutz’ Gesamtwerk einzuordnen. Was er herausfand, ließ ihn über die Signifikanz eines Selbstporträts mit dem Titel Self-Portrait as a Pachyderm (2005) sinnieren. Das Öl-auf-Leinwand-Gemälde zeigt einen voluminösen, leuchtend-hellen, roten Haarschopf, der einen wilden Rahmen um das entstellte Gesicht einer Frau mit faltiger, dunkelvioletter, schwarz-bräunlicher Haut bildet – mit anderen Worten, einer weißen Frau in Blackface.29
Das Weißsein in den Vordergrund stellen
So wie Empathie ohne Reflexivität ist das Schwarz-Werden eine prominente Form der weißen Verweigerung, sich dem eigenen Weißsein zu stellen. Arthur Jafas The White Album (2018) fängt die Merkmale dieser Ausflucht in chirurgisch präziser und, für die weißen Betrachter*innen, nahezu unerträglicher Weise ein. In seiner Video-Montage nimmt Jafa einen dezidiert schwarzen Blickwinkel ein und verschränkt Found-Footage-Aufnahmen mit Videomaterial von Unbekannten und Freund*innen, die über die Bedeutung des Weißseins philosophieren. Zwei Jahre zuvor hatte Jafas Kurzfilm Love is the Message, the Message is Death (2016) allerorts lobende Kritiken für seinen affektiven Zugang zur Blackness geerntet. In Anlehnung an die Techniken der schwarzen Musik bot der siebenminütige Film eine Assemblage aus zeitweise wunderschönen, dann wieder grotesken und komischen, meist aber erschütternden Bildern schwarzer Existenz, musikalisch unterlegt mit Kanye Wests Rap-Gospel „Ultralight Beam“. Jafa selbst merkte an, dass ihn die einhellig euphorische Reaktion auf seinen Film misstrauisch machte. In einem Interview mit Kurator Apsara DiQuinzio betonte er: „Sogar, wenn die Leute sagten, ‚Oh, ich musste weinen’, vermutete der zynische Teil meines Hirns eine gewisse unterschwellige Empathie in der Begegnung von schwarzen Leuten.“30
Mit seinem The White Album wollte Jafa wiederum auf die Schönheit und Verfremdung der schwarzen Musik Bezug nehmen, aber diesmal jede Empathie unmöglich machen. Er betonte erneut die Perspektive des schwarzen Blicks, wandte ihn aber dem zu, was (für das weiße Subjekt) üblicherweise unsichtbar oder zumindest im Hintergrund bleibt: Er fokussierte auf Weißsein und wechselte vom schnellen Schnitt seiner früheren Arbeit zu einem langen, unbeirrten Blick auf das Weißsein als Assemblage von scheinbar zufällig arrangierten Porträts – Mobiltelefon-Aufnahmen einer jungen blonden Frau, die sich in einer Flut an Platituden zum Thema „Rasse“ verliert; Szenen aus dem Musikvideo „The Pure and the Damned“ von Oneohtrix Point Never mit einem animierten Iggy Pop; unscharfe Überwachungskamerabilder der Ankunft eines jungen, weißen Mannes vor einer Kirche und, 45 Minuten später, sein Verlassen derselben (das Füllen der Zwischenzeit wird dem Wissen der Zuschauer*innen um die Geschehnisse in der Emanuel African Methodist Episcopal Church in Charleston, South Carolina, überlassen); Videoaufnahmen eines bärtigen Mannes, der Automatikfeuerwaffen aus seinen vielen Taschen zieht; das Videoporträt eines Mädchens kaum im Teenageralter, bekannt als Reality-Star Honey Boo Boo, die Anschuldigungen „schwarz zu spielen“ mit „Ho, you can’t act a color! […] You can be a color, but you can’t act a color” kontert. Über 30 Minuten – die exakte Filmlänge variiert je nach dem speziellen Schnitt, den Jafa für die verschiedenen Screenings anfertigt – bietet der Film seinen weißen Zuschauer*innen keine Figur, mit der sie sich identifizieren oder für die sie Empathie entwickeln könnten; keinen sicheren Halt oder beruhigenden Zufluchtsort. Wie die Tourette-artigen Zwänge des weißen Mannes in Handschellen am Boden, der nicht aufhören kann, der schwarzen Polizistin vor ihm aggressiv das N-Wort entgegen zu spucken, fühlt sich Weißsein zunehmend wie ein erbärmliches Gefangensein in einer Falle an, ein Narrenstück, das die Protagonist*innen, wider besseres Wissen, immer wieder aufführen.
John Akomfrah beschrieb Jafas Arbeit als eine Übung in „affektiver Nähe“. Jafa stellt scheinbar unzusammenhängende Bilder nebeneinander und fordert den/die Zuschauer*in auf, ähnlich der Techniken eines DJs, auf die Zwischenräume zu achten. Jafa nennt dies „schwarze Methodologie“, für ihn ist es ein Werk der Relationalität: „Ich versuche, meinen Bezug zu diesen Dingen insgesamt komplexer darzustellen, anstatt nur irgendwelche Aussagen zu treffen, was am Weißsein wahr oder falsch ist. Mich interessiert wahr oder falsch nicht, mich interessiert: So fühle ich mich im Verhältnis dazu.“ In dieser radikalen Offenheit lädt The White Album die Zuschauer*innen, insbesondere weiße, dazu ein, sich in den Dienst der Relationalität zu stellen. Das Werk verlangt von ihnen, sich in Beziehung zu den Bildern zu setzen, und auch zu den Lücken dazwischen. So ist es ein Aufruf, Verantwortung zu übernehmen; und eine großzügig geteilte Ausgangsbasis, die Hausaufgaben und das Ver/lernen der weißen Ignoranz in Angriff zu nehmen.
Postskriptum: Second Take
Als die Debatte um Open Casket in den Mainstream-Medien verebbt war, hob die Diskussion im Sommer 2018 noch einmal kurz an, und zwar mit dem Erscheinen eines neuen Bilds bei der LISTE Kunstmesse in Basel. Dort zeigte Hamishi Farahs Representation of Arlo (2018) in warmen Pastellfarben die idyllische Szene eines Kleinkinds mit wild gelocktem blondem Haar, rosigen Wangen und einem Spielzeug in seinen Händen. In der Beschreibung des Künstlers war das Werk eine Darstellung von Dana Schutz’ Sohn, angeblich basierend auf einem Foto, das er im Internet gefunden hatte. Während der Kunstmesse erregte das Bild keinen großen Aufruhr, aber als das deutsche Magazin Monopol Farahs Arbeit als „Rachekunst“ bezeichnete, sah sich das Magazin durch einen Aufschrei der Kritik veranlasst, zuerst einen schwarzen Balken über die Augen des Jungens zu legen und letztendlich das Bild von der Website zu nehmen.31 Dieser Aufschrei war in Farahs Argumentation genau das Thema seines Kunstwerks: „Die Reaktion der Betrachter*innen schafft nun die Situation, in der sie hoffentlich einen bestimmten Grad an Selbstreflexivität erlangt haben, nämlich hinsichtlich ihrer Reaktionen auf Situationen, in denen sich weiße Künstler*innen schwarze Körper aneignen“, wurde Farah zitiert. Das weiße Publikum, für das Open Casket gemacht worden war, schaute auf das Bild und sah zuallererst einen verletzten schwarzen Körper; dann schauten dieselben Leute auf Representation of Arlo und erkannten darin ein Kind, das Schutz vor den Blicken der Öffentlichkeit bedurfte. Ethik ist eine Pädagogik der Praxis.
Veröffentlicht in
Franz Thalmair (Hg.): Kunstraum Lakeside — Prozess | Process,
Verlag für moderne Kunst: Wien, 2020.
Download
1 Kenny, Devin: Facebook, 16. März 2017, https://www.facebook.com/devinkk/posts/658751390060.
2 Young, Scott W. H.: „Hannah Black’s Letter to the Whitney Biennial’s Curators: Dana Schutz painting ‚Must Go’“, in eflux conversations, 17. März 2017, https://conversations.e-flux.com/t/hannah-blacks-letter-to-the-whitney-biennials-curators-dana-schutz-painting-must-go/6287.
3 Larson-Walker, Lisa: “The Problem With the Whitney Biennial’s Emmett Till Painting Isn’t That the Artist Is White”, in Slate, 29. March 2017, https://slate.com/culture/2017/03/the-problem-with-the-whitney-biennial-s-emmett-till-painting-isn-t-that-the-artist-is-white.html.
4 Rankine, Claudia: „The Condition of Black Life Is One of Mourning“, in The New York Times Magazine, 22. Juni 2015, https://www.nytimes.com/2015/06/22/magazine/the-condition-of-black-life-is-one-of-mourning.html.
5 Livingstone, Josephine und Lovia Gyarkye: „The Case Against Dana Schutz“, in The New Republic, 22. März 2017, https://newrepublic.com/article/141506/case-dana-schutz.
6 Bebe Moore Campbells Roman Your Blues Ain’t Like Mine, Toni Morrisons Theaterstück „Dreaming Emmett“, Gwendolyn Brooks’ Gedichte „A Bronzeville Mother Loiters in Mississippi. Meanwhile, a Mississippi Mother Burns Bacon“ und „The Last Quatrain of the Ballad of Emmett Till“ oder Audre Lordes Gedicht „Afterimages“.
7 Alexander, Elizabeth: „‚Can You Be BLACK and Look At This’: Reading the Rodney King Video(s)“, in Public Culture 7 / 1994, 77–94.
8 Vgl. Sharpe, Christina: In the Wake: On Blackness and Being, Durham: Duke University Press 2016.
9 Sharpe zitiert in Siddhartha Mitter, „‚What Does It Mean to Be Black and Look at This?’ A Scholar Reflects on the Dana Schutz Controversy“, in Hyperallergic, 24. März 2017, https://hyperallergic.com/368012/what-does-it-mean-to-be-black-and-look-at-this-a-scholar-reflects-on-the-dana-schutz-controversy.
10 Vgl. Tate, Greg: Everything But the Burden. What White People Are Taking from Black Culture, New York: Broadway Books 2003.
11 Kennedy, Randy: „White Artist’s Painting of Emmett Till at Whitney Biennial Draws Protests“, in The New York Times Magazine, 21. März 2017, https://www.nytimes.com/2017/03/21/arts/design/painting-of-emmett-till-at-whitney-biennial-draws-protests.html.
12 Bondi, Liz: „Empathy and Identification: Conceptual Resources for Feminist Fieldwork“, in ACME. An International Journal of Critical Geography 2, Nr. 1 / 2003, 64–76.
13 hooks, bell: „Marginality as a Site of Resistance“, in Out There. Marginalization and Contemporary Cultures, hg. v. Russell Ferguson et al., New York: Routledge 1990, 343.
14 Hartman, Saidiya: Scenes of Subjection. Terror, Slavery and the Self-Making in Nineteenth Century America, Oxford: Oxford University Press 1997, 19.
15 Ebd.
16 Vgl. Campt, Tina: Listening to Images, Durham: Duke University Press, 2017; Tina Campt in ihrer Vorlesung „Prelude to a New Black Gaze“ an der Akademie der bildenden Künste Wien, 12. April 2019.
17 Sexton, Jared: „The Rage: Some Closing Comments on ‚Open Casket’“, in contemptorary 21. Mai 2017, https://contemptorary.org/the-rage-sexton.
18 Miranda, Carolina A.: „Q&A: Samuel Durant was pressured into taking down his ‚Scaffold’. Why doesn’t he feel censored?“ in The Los Angeles Times, 17. Juni 2017, https://www.latimes.com/entertainment/arts/la-et-cam-sam-durant-scaffold-interview-20170617-htmlstory.html.
19 Vgl. Tuck, Eve und Monique Guishard: „Uncollapsing Ethics: Racialized Sciencism, Settler Coloniality, and Ethical Framework of Decolonial Participatory Action Research“, in Challenging Status Quo Retrenchment – New Directions in Critical Research, hg. v. Tricia M. Kress, Curry Malott und Brad Porfilio, Boston: The University of Massachusetts, 2013, 3–28.
20 Denzin, Norman: „IRBs and the Turn to Indigenous Research Ethics“, in Advances in Program Evaluation 12, August 2008, 97–123.
21 Vgl. Haraway, Donna: „Situiertes Wissen: Die Wissenschaftsfrage im Feminismus und das Privileg einer partialen Perspektive“, in Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen, hg. u. eingel. v. Carmen Hammer und Immanuel Stieß, Frankfurt a. M.: Campus 1995, 73–97.
22 Smith, Linda Tuhiwai: Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples, London: Zed Books, 2012, 30.
23 Vgl. Sundberg, Juanita: „Ethics, Entanglement, and Political Ecology“, in The Routledge Handbook of Political Ecology, hg. v. Tom Perreault, Gavin Bridge und James McCarthy, New York: Routledge, 2015, 120.
24 Vgl. Spivak, Gayatri: The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, New York: Routledge, 1990.
25 Vgl. Kuokkanen, Rauna: „The Responsibility of the Academy. A Call for Doing Homework“, in Journal of Curriculum Theorizing 26, Nr. 3 / 2010, 61–74.
26 Sundberg: „Ethics“, 120.
27 Vgl. Wilderson, Frank: Red, White and Black: Cinema and the Structure of U.S. Antagonisms, Durham: Duke University Press, 2010.
28 Pelster-Wiebe, Angela: „White Artists Need to Start Addressing Supremacy in Their Work“, in Literary Hub, 29 August 2018, https://lithub.com/white-artists-need-to-start-addressing-white-supremacy-in-their-work.
29 Vgl. Baker, George: „Pachyderm – George Baker on Painting, Critique, and Empathy in the Emmett Till / Whitney Biennial Debate“, in Texte zur Kunst, 29. März 2017, https://www.textezurkunst.de/articles/baker-pachyderm.
30 Little, Colony: „In ‚The White Album’, Arthur Jafa Invents a New Film Language to Take on the Clichés of Empathy“, in Artnet News, 25. Jänner 2019, https://news.artnet.com/exhibitions/arthur-jafa-white-album-1448167.
31 Vgl. Hohmann, Silke: „Kunst als Rache. Künstler malt Sohn von Dana Schutz“, in Monopol. Magazin für Kunst und Leben, 15. Juni 2018, https://www.monopol-magazin.de/kuenstler-malt-sohn-von-dana-schutz.